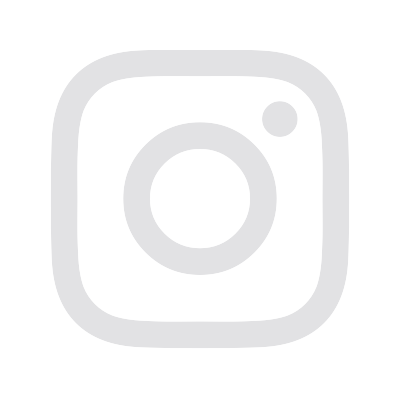Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.
















Eine Tragödie der Erkenntnis von Albert Camus · 16+
Schwarzwälder bote, 19. Februar 2025
Tiefe Verachtung verpackt in Silberfolie
(von Christoph Holbein)
Was geschieht, wenn sich maßloser Machtwille paart mit Wahnsinn, wenn ein Politiker nicht mehr durch Ethik, Gesetze und Moral gezähmt ist, das zeigt Albert Camus in seinem Stück „Caligula“ auf. Regisseur Dominik Günther hat das Schauspiel in der Werkstatt des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT) inszeniert – mit viel Kreativität.
Es ist ein Strudel aus Willkür und Fake News, aus Angst und Schrecken, in den der junge römische Kaiser Caligula die Bevölkerung hineinzieht. In dem Versuch, das Unmögliche zu erreichen, den Mond in den Händen zu halten, die eigene Wahrheit den Menschen aufzuzwingen, mündet die Sehnsucht nach schrankenloser Freiheit in Gesetzlosigkeit – und die Nächstenliebe bleibt auf der Strecke. Die Inszenierung von Dominik Günther in dem in Silberfolie erstrahlenden Bühnenbild von Sandra Fox wirft ein Schlaglicht auf diejenigen, die einen solchen Despoten erst möglich machen, auf die Machtelite, die Günstlinge, Opportunisten und Taktiker, die um ihrer Pfründe willen, den sadistischen Tyrannen sein Unwesen bis zum Exzess treiben lassen.
Diesen sarkastischen Zynismus arbeitet die LTT-Inszenierung fein heraus: „Es fehlt uns nicht an Kaisern, es fehlt uns an Leuten mit Charakter.“ Für Leben auf der Bühne sorgen dabei Tanz, Musik und körperliches Ausbalancieren, auch wenn manches ein wenig statisch bleibt. Die von Günther gesetzten Bilder vermitteln plakativ das Ausgeliefertsein und sich ausliefern wollen. Das gute Mienenspiel des schauspielerisch bestens aufgelegten Ensembles trägt seinen Teil zum Gelingen der Inszenierung bei, die mit zarten aktuellen Anspielungen agiert, etwa mit einer Jubel-Gestik ins Publikum, die stark an Elon Musk erinnert. Diese Körperspiele und athletischen Einlagen, ja fast sphärischen Bewegungen rund um und auf den römischen Ruinen-Säulen verdichten die Atmosphäre, in der zwischendurch auch immer wieder ein gewisser Humor durchblitzt. Das spitzt sich zu hin zu mitunter überdrehten Szenen. Da knallt die Peitsche, da wird der Wahnsinn plastisch, wozu das junge Ensemble-Mitglied Jonas Hellenkemper mit seiner erfrischenden Interpretation des Caligula maßgeblich beiträgt.
Im choreografierten Disco-Tanz wird die leise Ironie greifbar. In der Akrobatik der Figuren offenbart sich eine skurril-moderne Szenerie. Auf dem silberfarbenen Pferd nimmt Caligula eine abartige Anbetungszeremonie entgegen voll wahnsinniger Absurdität - in einer Monumentalität, die den Größenwahn plastisch werden lässt. Das ist in den Figuren gut umgesetzt, symbolisiert in körperlichen Verrenkungen, Verwicklungen und Verspielungen, in einer sehr affektierten Darstellung - und mündet bei der getanzten Hinrichtungsszenerie in einer beeindruckenden Performance.
Ein wenig leidet die Inszenierung allerdings an Längen, das Ganze etwas zu straffen, würde nicht schaden und für die Botschaft keinen Abbruch bedeuten. Auch ein klein bisschen weniger Pathos stünde der Inszenierung gut zu Gesichte. Am Ende, wenn alles unter dem großen Tuch verhüllt ist, bleibt trotzdem der Eindruck eines starken, energiegeladenen Theaterabends.
Reutlinger General-Anzeiger, 11. Februar 2025
Der Kaiser, der den Mond haben wollte
(von Thomas Morawitzky)
Albert Camus’ »Caligula« über den römischen Kaiser wird am LTT zum großen Abend für Jonas Hellenkemper
Wenn Caligula schläft, bedeckt ihn ein matt schimmerndes, schwarzes Tuch. Das Tuch wird er um sich schlingen, wenn er kreischend über die Bühne rennt. Er trägt es als Mantel, er zerrt es zuletzt über die silbernen Steine, Stelen, das silberne Pferd, ehe er wissenden Auges in den Tod geht. Caligula wollte Gott sein. Seine Gefolgsleute strafen ihn so blutig und grausam, wie er selbst regierte. Und er begrüßt es.
Das dunkel glänzende Tuch, das durch Dominik Günthers Inszenierung von Albert Camus’ Drama weht, könnte der Wahnsinn sein, in den sich der römische Kaiser verrannte. Aber vielleicht, und dies legt Camus nahe, war Caligula gar nicht verrückt. Vielleicht war er so hellsichtig wie hochmütig. »Eine Tragödie der Erkenntnis« – so heißt das Stück im Untertitel.
Sandra Fox hat Bühne und Kostüme ganz in Silber und matten Anthrazittönen gehalten. Wie ein retrofuturistischer Disco-Chic wirken diese Kostüme. Zu Beginn ist die Bühne noch leer, bis auf Caligula, der dort liegt, unter seinem Tuch. Caesonia (Rosalba Salomon), seine Frau, und Scipio (Lucas Riedle), sein Jugendfreund, umkreisen ihn.
Caligula ist ein noch junger Mann. Drusilla, seine vergötterte Schwester, ist tot. Drei Tage lang rührt er sich nicht. Er spürt die Willkür des Schicksals, die Bedeutungslosigkeit des Lebens. Zum Schicksal will er sich also selbst erheben und beginnt, wahllos Mordbefehle auszusprechen, demütigt die Bürger Roms, befreit die Sklaven, schickt den Senat ins Hurenhaus. »Bring mir den Mond!«, befiehlt er seinem Diener Helicon (Andreas Guglielmetti). »Das ist etwas, das ich noch nicht hab!«
Immer mehr wird sich der Raum um Caligula füllen – mit den Stelen, den Steinen, die der Kaiser schleppen lässt, einem übergroßen Fuß, wenn er sich die Nägel anmalen möchte, einem Pferd. All das schimmert silbern wie im Mondlicht.
Aber die Stelen sind Trümmer, die Steine sind aus Pappe. Cassius Chaera, ein Prätorianer, trägt Brille und Hemd. In Rom wird kühl und modern getanzt. Einmal holen Caligula, Caesonia und Helicon sich den Applaus des Theaterpublikums, indem sie eine Britney-Spears-Nummer aufführen: »Oops…! I did it again!« Die Prätorianer auf der Bühne dagegen schauen angewidert drein. Antike und Gegenwart vermischen sich. Gelegentlich werden Geräusche eingespielt, Stimmen, die eine Mondlandung erahnen lassen – vielleicht denkt man hier an reiche Menschen von heute, die in den Weltraum reisen.
Caligula, so wie Camus ihn zeichnet, besitzt jedoch mehr Tiefe, Seele, als man sie einem Trump oder Musk je zutrauen würde. Er ist eine tatsächlich schwierige, philosophische Figur. »Es fällt mir leicht zu töten«, sagt er, »da es mir leicht fällt, zu sterben.« Dass es eine andere, viel bescheidenere Form gibt, das Leben anzunehmen, wird er von Scipio erfahren. Lucas Riedle gibt Caligulas Freund und Gegenspieler ruhig, besonnen, mit vorsichtiger Zurückhaltung.
Jonas Hellenkemper derweil spielt den Caligula mit all seinen Ambivalenzen, zeigt ihn jungenhaft triumphierend, böse, willkürlich, bitter und immer gehetzter, je mehr er seinen eigenen Tod herbeisehnt. Es gibt Momente, in denen das Ungeheuer kindlich und verletzlich wirkt.
Rosalba Salomon als Caesonia schwingt die Peitsche, bleibt dem Kaiser treu, hart und vulgär. Helicon an ihrer Seite hasst die vornehme römische Gesellschaft für ihre Verlogenheit. Gilbert Mieroph, ein Patrizier, wird von Caligula gedemütigt, muss zusehen, durch einen Spalt im Vorhang, wie seine Frau Schlimmes erleidet. Und Rolf Kindermann, als Chaera, blickt in einer Szene nur sehr, sehr müde zu Caligula hin und sagt: »Weil ich nicht gern lüge.«
Etwas bemüht wirkt er, der Versuch, Camus’ Drama an der Gegenwart anzudocken – davon abgesehen bietet dieser Abend eine beeindruckend abgründige Vorstellung mit einem starken Ensemble, einem starken Hauptdarsteller.
Schwäbisches Tagblatt, 10. Februar 2025
Wer links raus geht, wird ermordet
(von Peter Ertle)
Ähnlichkeiten und Unterschiede zu heutigen Willkürherrschern: Im LTT tobt nun Albert Camus' Caligula durch sein römisches Kinderzimmer.
Freitag Lindenhof Melchingen: Ein Reicher drangsaliert kraft seines Geldes und der damit verbundenen Macht einen kleinen schwäbischen Hüttenbesitzer (folgt morgen). Samstag Landestheater: Ein Willkürherrscher verbreitet Angst und Schrecken und auch etwas Bewunderung (folgt hier).
Zufall sind solche Themen nicht. Die Welt, im Kleinen wie im Großen, wird momentan einfach von zu vielen durchgeknallten Despoten bevölkert. Camus nun schrieb seinen Caligula als 25-Jähriger, er erschien 1938, da hatte Hitler gerade mal Österreich „heimgeholt“. Dass der Schriftsteller später betonte, sein Stück sei weder ein politisches noch ein philosophisches, mag seiner Angst, verengt, vereinnahmt, in Schubladen gesteckt zu werden, geschuldet sein. „Ein Drama der Erkenntnis“ nannte er das Stück. Ja. Und als solches ist es: Ein philosophisches und politisches Stück par excellence.
Im LTT haben sie ein paar nette Schnörkel eingebaut, um die Wand der so verspielten wie verquast verkopften Kindergedanken dieses narzisstischen, kriminell geistesgestörten Kaisers etwas aufzulockern. Zum Beispiel mithilfe einer hübsch choreographierten Dance-Einlage, samt Song, in einer Dominik-Günther-Regie darf das nicht fehlen. Und gleich zu Beginn darf Caligulas Gespielin Caesonia mit einem „Hat's schon angefangen?“ als verspätete Zuschauerin in die Werkstatt platzen, die raschelnde Chipstüte herausholen und mit einem „Es geht ja immer noch nicht los“ plump, selbstbezogen und kunstverachtend das Ganze hier in Frage stellen. Ähnlich verächtlich, wenn auch etwas süß und komplimenthaft verpackt wird sich später Caligula über Scipios Gedichte äußern. Ja, die Kunst gehört immer zu den ersten Opfern, von den Menschen mal ganz zu schweigen. Bühnenbildnerin Sandra Fox setzt sie hier in eine silbern glitzernde Prunkwelt. Die Staatskasse sei das Wichtigste, überhaupt sei Geld allen Menschen das Wichtigste, deshalb solle Geld auch Vorrang vor dem Menschen haben. So lautet einer der vielen Kurzschlüsse Caligulas, die bequem sind und ihn vielleicht auch mehr amüsieren, als dass er wirklich an sie glaubt. „Die Menschen sterben und sie sind unglücklich“ lautet eine weitere Erkenntnis Caligulas. Warum also so viel Aufhebens um sie machen? Wenn das Unglück doch nur übertönen kann, wer an der eigenen Stärke und Bosheit berauscht?
Camus war Mitte 20, als er das Stück schrieb, Caligula war Mitte 20, als er an die Macht kam, Caligula-Darsteller Jonas Hellenkemper ist Mitte 20. Und wenn man sich dazu das eigentümliche Jungengesicht von Elon Musk vorstellt, den unser Caligula mit ein paar Gesten auch mal zitiert, wird daraus schon ein Schuh. Ein bisschen unheimlich wird es, wenn bei Camus Caligulas größte Sehnsucht dem Mond gilt. Und man sich Musks Space X und seine Jugendliebe für Superman und Batman hinzudenkt.
Aber weiter, konkreter wird es da nicht in Richtung eines Musk, Putin, Trump, Milei oder – man kann sie nicht mehr alle aufzählen. Was wiederum das Allgemeine angeht, gibt es in der Charakterisierung und psychologischen Motivierung Caligulas mindestens einen großen Unterschied zu den Heutigen, allerdings auch eine große Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit zeigt sich vor allem, als Helicon, früher Sklave, nun in Diensten (oder soll man sagen unterm Joch?) Caligulas, sich an den Schriftsteller und Caligula-Mordplaner Charea wendet und ihm sein früheres Sklavenschicksal, sprich die Klassenunterschiede, Lügen und Privilegien in der damaligen Demokratie vorhält, um sich dann als stolzen Caligulianer zu zeigen: Da haben wir genau die Gründe heutiger Demokratieverachtung und Autoritätsverehrung gerade deklassierter Menschen auf dem Tablett. Der große Unterschied aber: Während Caligulas Absage an die Humanität gerade durch das als sinnlos und absurd erkannte Dasein begründet wird, beglaubigen sich die heutigen reaktionären Kräfte und Herrscher nach außen hin gerade dadurch, dass sie bei aller disruptiven Muskelspielerei eine gestrige, scheinbar heile Werte-Welt einer angeblich orientierungslosen, aus den Fugen geratenen Jetztwelt entgegenhalten.
Solange wir es zulassen
Caligula ist insofern dann doch nur: Caligula. Und das Drama über weite Strecken die etwas komplizierte Philosophiestunde eines Irren, der sich irgendwann gottgleich zur Venus kürt. Um ihn herum ängstliche Patrizier (Gilbert Mieroph), Gefolgsleute (Andreas Guglielmetti als Helicon), Gespielinnen (Rosalba Salomon als Caesonia) oder ihm in Grenzen die Stirn bietende Intellektuelle und Schriftsteller (Lucas Riedle als Scipio, Rolf Kindermann als Charea). Vor ihnen hat Caligula Respekt, kann aber halt sein, dass er sie trotzdem über die Klinge springen lässt. Wer rechts rausgeht, wird ermordet, wer links rausgeht, überlebt. Oder genau andersrum. Weil russisch Roulette Spaß macht und in absoluter Willkür die Freiheit am schönsten zur Geltung kommt. Ach, dass Caligulas Leiden an der Welt, sein persönlicher Schmerz (seine geliebte Schwester starb) und eine unbedingte Freiheits- und Lebensliebe ihn zu seiner menschenverachtenden Verirrung gebracht haben, es sollte uns eigentlich egal sein. Die soweit noch verständnisvolle, positive Grundierung des Herrschers hat eh nur damit zu tun, dass der junge Camus leidenschaftliche Selbstverwirklichungs- und Entgrenzungsfantasien hatte, gepaart mit der Sehnsucht nach dem einfachen, sonnenbestrahlten Leben der Kindheit. Das logische Feindbild dazu war die falsche, spießbürgerlich-selbstzufriedene Welt der Lebensflüchter und Allesregulierer. Aber Camus sah bereits, wo das, als Egotrip weitergedacht, endet. Schon damals galten seine Sympathien vielmehr Charea als einem Stellvertreter des erniedrigten und revoltierenden Menschen. 1957 hat der Autor das in seiner Rede anlässlich des Literaturnobelpreises nochmal auf den Punkt gebracht, als er sagte, „dass ein Schriftsteller sich seiner Bestimmung gemäß heute nicht in den Dienst derer stellen kann, die Geschichte machen: er steht im Dienst derer, die sie erleiden.“
Dass Caligua auch seine Caesonia ermordet, am Ende seinen Irrweg erkennt und sich seinen Mördern willig anbietet: haben wir jetzt alles nicht gesehen im LTT. Nur eine gewisse Furchtlosigkeit, eine konsequente Schicksalsbejahung war zu registrieren. Und dass er, obschon mehrfach erstochen, letztlich nicht sterben kann. Beides ist bezeichnend: Die Caligulas werden nie reumütig. Ersticht man einen, wächst irgendwo ein neuer nach. Solange wir es zulassen.