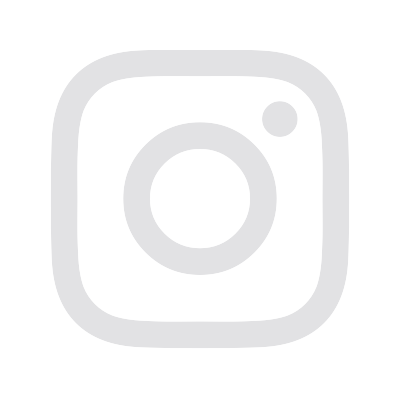Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.














Nach dem Roman von Miranda July · Deutsch von Stefanie Jacobs
Schwarzwälder Bote, 7. März 2023
(von Christoph Holbein)
In „Der erste fiese Typ“ geht es um gesellschaftliche Anpassung und Emanzipation.
Um das Positive vorneweg zu nennen: Schauspielerisch präsentiert das Ensemble eine gute Leistung: Franziska Beyer, Insa Jebens und Julia Staufer zeigen sich bestens aufgelegt und inspiriert. Die Inszenierung des Stückes „Der erste fiese Typ“ nach dem Roman von Miranda July am Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen dagegen erweist sich als theatralisch schwere Kost mit Längen, die Gefahr läuft, in einen insgesamt langatmigen, ja öden Abend zu versinken. Der Fassung von Romy Lehmann gelingt es nicht durchgehend, den wesentlichen Kern zu projizieren, diese Gratwanderung zwischen Emanzipation und Angepasstheit an die gesellschaftlichen Gegebenheiten. Im Sammelsurium der Worte bleibt die Aussage im Nebulösen.
In den Polstergarnituren eines Möbelhauses entwickelt die Inszenierung einen leisen Witz mit viel Bewegung. Das ist mitunter tänzerisch choreografiert und synchronisiert. Schön gemimt von den drei Protagonistinnen prasseln jede Menge Worte auf die Zuschauer ein – darunter auch ausschweifend die sexuellen und erotischen Phantasien der Hauptfigur. Und Grenzen sind keine gesetzt: Da wird auch mal hinter dem Sofa in einen Papp-Essenskarton uriniert. Gerangel, Gelaufe, Gewalt – es ist einiges los auf der Bühne, immer wieder schräg übersteigert, aber auch auf Dauer ziemlich anstrengend. Der letzte Funke will nicht überspringen.
Im zweiten Teil sind dann alle Möbel bis auf ein Aquarium weggeräumt: Auf der leeren Bühne wirkt die Inszenierung jetzt noch mehr aufgesetzt und gekünstelt. Die Darstellungen entbehren nicht eines drastischen Realismus, gepaart mit fast sarkastischer Ironie - alleine das aber ist nur ein fragiles Fundament, den Theaterabend in seiner Gänze zu tragen.
Schwäbisches Tagblatt, 21. Februar 2023
Cheryl und Clee, allein zuhaus
(von Peter Ertle)
Im Landestheater wurde Miranda Julys Roman „Der erste fiese Typ“ zum Theaterstück. Es gibt: Frauen, tough und konfus, den skurrilen Wunderkammerblick der Autorin – und manchmal sogar Klamotte.
Um mit einem persönlichen Einstieg zu beginnen: Vor einem knappen Jahrzehnt entdeckte man Miranda July, sah ihren ersten Langfilm „Me and You and Everyone We Know“, dann „ The Future“, las schließlich ein Buch von ihr, in dem sie beschreibt, wie sie auf Kleinanzeigen hin Leute besucht, nicht weil sie an den dort angebotenen Dingen interessiert ist, vielmehr interessieren sie die Menschen und eigenartigen Welten, denen sie da begegnet. Seitdem immer wieder der Gedanke: Sollte man das nicht als Rubrik für die Zeitung übernehmen?
Natürlich musste dann auch sofort ihr erster Roman her, „Der erste fiese Typ“. Man wurde aber nicht warm damit, hörte irgendwann zu lesen auf. Naja, dachte man sich jetzt. Statt ihn nochmal herzunehmen: Gehst du doch mal ins LTT. Dort hat Romy Lehmann das Ding zum Theaterstück umgebaut. Gleich vorneweg: Man hat es nicht bereut.
Auf der Bühne: drei Schauspielerinnen. Etwas verwirrend zu Beginn, Konzentration ist gefordert bei diesem Rolle-wechsel-dich-Spiel, das zur Zeit ja sehr angesagt ist – und wofür sich meist herzeigbare Gründe finden. In diesem Stück sowieso: Das fluide Spiel der Identitäten und Geschlechter ist ein Motiv in Roman und Stück.
Auch wenn eine Theaterkritik keine Nacherzählung der Story ist, so viel Story muss jetzt doch sein: Cheryl, Mitte vierzig, schrullig, pedantisch und etwas zwangsgesteuert, bekommt für einige Zeit das junge Ding Clee, Tochter ihres Chefs, einquartiert. Cheryl ist außerdem in einen über 60-jährigen Mann verknallt (er ist nur via Telefon und SMS-Nachrichten präsent). Der sie aber nur als Vertraute ansieht, seinerseits in eine 16-Jährige verknallt ist (und die in ihn) und nun von ihr, Cheryl, quasi als Richterin, grünes Licht für die Liebesbeziehung haben möchte, während Clee, pubertär und dauerglotzend vor sich hin muffelnd auf dem Sofa lebt und Cheryls Welt durcheinanderbringt. So sehr, dass es zu regelmäßigen, physischen Kämpfen zwischen beiden kommt, die deutlich erotischen Charakter haben – und auf Cheryl eine so beängstigende wie befreiende Wirkung.
So weit mal. Skurril? Ja, so ist die Welt Miranda Julys, voller Eigenheiten, Peinlichkeiten und Obsessionen, aber ganz schamlos und moralinfrei, dafür mit einer Mischung aus Humor und einem Freiheitsdrang, der sich als emanzipatorischer, durchaus feministischer Impuls versteht – doch nie ideologisch wird. Das hat etwas Unschuldiges, Verträumtes, dabei aber seine Freude an mittleren Abgründen, kleinen Frechheiten und Tabubrüchen, alles im heiteren, sanft-melancholischen July-Ton, von Fall zu Fall gespickt mit gnadenlos harten, pointentauglichen Wahrheiten. Lena Dunhams Schwester im Geiste.
Girls: Schon der erste Anblick (Bühne, Kostüme: Hannah von Eiff) ist sehr komisch. Eine Sofalandschaft mit Aquarium, oben hängt ein Zettel wie von Ikea, das Polster trägt komischerweise den Namen des Gärtners. Hinten ein Schild, auf dem „Bäder“ steht, mit einem Pfeil. Vermutlich der Ort, den Clee nie benutzt.
Eine orangefarbene Merkelfrisur (Insa Jebens). Dann ein Achtziger-Jahre-Look (Franziska Beyer), vielleicht ist Cheryl modisch stehen geblieben, seit sie selbst 16 war. Dann eine freche Latzhose: Julia Staufer mit viel gelangweiltem Teenienullbockblick und manch durchblitzender Leidenschaft
Dann gibt es: Telefonate mit IHM, seine SMS-Nachrichten, die Zuschauer lesen sie auf dem TV-Bildschirm: Sie habe sein steifes Glied in der Hand gehabt, aber nicht bewegt. So weit seien sie jetzt. Ob sie dürfen? Dazwischen sitzt Cheryl immer wieder bei ihrer Psychotherapeutin. Da das Klo dort zu weit weg ist, pullert sie auch mal hinterm Sofa lautverstärkt in eine Box, deren Inhalt wenig später im Gesicht der Kollegin landet. Ja, es hat zwischendurch klamottenhafte Züge, die Insa Jebens am Premierenabend mal zu einem aus der Rolle fallenden Lachen bringen. Lustig.
Neben der Urinbox ist auch von Scheiße, Sperma und stinkenden Füßen die Rede: Zwischenzeitlich fragt man sich, ob man jetzt unversehens in Charlotte Roches „Feuchtgebieten“ gelandet ist. Aber nur ganz kurz. In dieser Inszenierung gibt es nichts wirklich Obszönes. Es ist ihr bloß nichts Menschliches fremd. Bei July wird alles sofort transzendiert. In die Kunst. Beziehungsweise ein zweites Leben, in dem Geheimnisse öffentlich werden dürfen. Cheryl braucht zum Beispiel immer diese eine, ganz eigene Fantasie, um zum Orgasmus zu kommen. Sagt sie. Sie steht auf Männer, ist aber offenbar auch bi, fantasiert sich beim Sex mitunter selbst zum Mann. Das hat sicher auch eine Empowerment-Seite: Sei wie du bist. Mehr Mission ist da aber nicht. Es würde auch weggelacht durch die bizarr putzige Alltagskomik, das einzige Sendungsbewusstsein, zum Beispiel Cheryls Tipps zur Gestaltung besserer Alltagsökonomie: Man solle die Schmutzwäsche ohne Wäschekorbzwischenstation gleich in die Trommel tun, bei jedem Gang im Haus immer gleich mehrere Sachen auf einmal transportieren, und – als valentinesker Abschuss – damit nichts unnötig rumliegt, beim Lesen eines Buchs gleich neben dem Regal sitzen bleiben, den Finger einer Hand in der Regallücke, aus der man das Buch gerade genommen hat.
Dann wird Clee schwanger. So viel darf man erzählen, ohne zu spoilern. Cheryl wird eine Art Ersatzmutter. Beziehungsweise Ersatzoma. Mutter, Feindin und Geliebte gleichzeitig ist sie ja schon – irgendwie. Übrigens wurde auch Miranda July schwanger. So also fand das echte Leben im Buch seinen Niederschlag und sorgt nach der Pause für eine Bühne, die vor allem eines ist: aufgeräumt.
So ein Kind macht halt alles anders. Und, klar, Clee und SEINE 16-Jährige Freundin – man hat das ganze Stück drauf gewartet, dass der Bogen mal geschlagen wird. Ist am Ende aber gar nicht so wichtig. So. Und jetzt lesen wir doch weiter im Buch. Ob das da alles auch so drin steht. Wahrscheinlich schon.
Reutlinger General-Anzeiger, 20. Februar 2023
(von Kathrin Kipp)
»Erst war ich ihre Feindin, dann ihre Mutter und dann ihre Geliebte«: am LTT geht’s mit dem neuen Stück »Der erste fiese Typ« drunter und drüber.
»Erst war ich ihre Feindin, dann ihre Mutter und dann ihre Geliebte«: am LTT geht’s mit dem neuen Stück »Der erste fiese Typ« drunter und drüber. Der Roman der US-amerikanischen Multimedia-Künstlerin Miranda July von 2015 wurde von Romy Lehmann (Regie) und Adrian Herrmann (Dramaturgie) für die LTT-Bühne aufbereitet und erzählt die Geschichte der Angestellten Cheryl.
Deren langweiliges Leben kommt durch ihre neue, von ihren Chefs aufgezwungene Mitbewohnerin noch mal so richtig in Schwung – vor allem im Kopf. Denn sowohl bei Cheryl als auch auf der Bühne verschwinden schnell die Grenzen zwischen den Figuren und Geschlechtern, zwischen Realität und Fantasie, zwischen Sex und Gewalt, zwischen »echtem« Theater und szenischer Lesung. Weil das Regieteam den Roman als Erzähltheater mit drei Schauspielerinnen in ständig wechselnden Rollen erzählen lässt. Und zwar in so einem hohen Tempo, dass man am Ende nicht mal mehr weiß, wer man selbst ist, geschweige denn, wer die Frauen auf der Bühne gerade sind.
Ausstatterin Hannah von Eiff hat die irre Selbstfindungs- und -entgrenzungs-Sause in die rustikale Sofa-Abteilung eines Möbelhauses gepflanzt, wo sich die Spuren von Cheryls und Clees bald ebenfalls recht rustikal ausgetragener Feindschaft tief in die Sofalandschaft graben. Alles ist in Orange und hellen Brauntönen gehalten: Fifty Shades of Beige, quasi.
Franziska Beyer, Insa Jebens und Julia Staufer teilen sich die Ich-Erzählerin und sämtliche Figuren untereinander auf. Franziska Beyer bleibt schwerpunktmäßig bei der neurotischen Cheryl mit psychosomatischem Kloß im Hals. Ihre innere Sofalandschaft gerät schnell durcheinander, als sich die nervtötende Clee (vorwiegend gespielt von Julia Staufer) bei ihr einnistet und Wohnzimmer sowie Glotze in Beschlag nimmt. Clee ist degeneriert und antriebslos, hat es nicht so mit der Hygiene, dafür aber Messi-Tendenzen und streng riechenden Fußpilz.
Cheryl flüchtet sich noch einmal in die Fantasien ihrer unerwiderten Liebe zu Philipp. Ein Arschloch, das sie nur als seelischen Mülleimer benutzt: Sie soll ihren Segen dazu geben, dass er was mit einer Minderjährigen hat. Philipps Sex-Text-Nachrichten ploppen immer im Fernseher auf, auf der Bühne wird er durch eine Sofakissen-Wühlkiste mit Sonderangeboten repräsentiert – eine neckische Idee, während sich ansonsten die multiple Erzählorgie mit gespielten Szenen als eher anstrengend, langweilig und wenig inspirierend präsentiert. Frauen haben ihre eigenen Pornos im Kopf? Ja, danke für die Botschaft.
Cheryl und Clee jedenfalls feiern ihre Feindschaft, indem sie die Workout-Selbstverteidigungsclips aus Cheryls Firma nachspielen und dabei zunehmend Lust an ihren Gewaltexzessen finden. Es fliegen asiatische Nudeln durchs Wohnzimmer und Urin spritzt übers Terrarium. Wenn nicht gerade intensiv getextet, gestöhnt, geräkelt, geschnauft, gejagt, gekämpft oder gezittert wird, sitzt Cheryl bei ihrer semiseriösen Therapeutin (meistens Insa Jebens) und multipliziert einmal mehr die Perspektive auf sich selbst.
Die drei Schauspielerinnen geben wirklich alles, müssen aber so viel Text bewältigen, dass das Stück blutleer bleibt. Vielleicht taugt der Roman auch einfach nicht für die Bühne. Als mit der gewaltlustigen Clee nichts mehr geht, besinnt sich Cheryl auf sich selbst als Philipp und dessen Sexfantasien. Oder ist das jetzt ihr »Ding«? Wie auch immer, es wird mit allen möglichen Stereotypen jongliert, eine Schneckeninvasion kommt ins Spiel, es herrscht Rausch und Ekel, bis Clee plötzlich schwanger ist. Ausgerechnet von Philipp. Es kommt zum Äußersten – einer Geburt. Ein Ereignis voller Schmerz, Schleim und anderen Körpersachen. Cheryl ist ganz im Mutterglück, Cheryl und Clee verlieben sich ineinander. Happy End? Natürlich nicht.