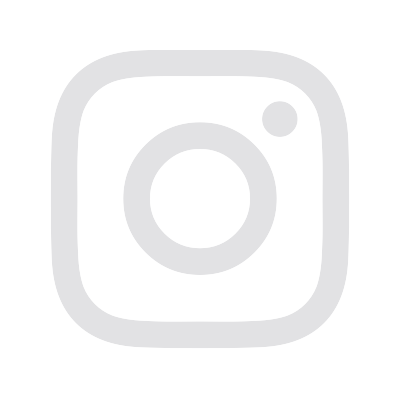Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.









nach dem Roman von Franz Kafka
Schwäbisches Tagblatt, 31. März 2021
Betrachten Sie mich als Traum!
(von Peter Ertle)
Im LTT wurde eine Grunderfahrung der Moderne vom prototypischen Roman zum Stück für
vier Schauspieler. Welcher Prozess warum auch immer: Er kommt nicht voran und stellt
doch alles in den Schatten.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde
er eines Morgens verhaftet.“ Die berühmten ersten Sätze, im Chor. Hier spricht ja keine Figur,
sondern der Erzähler. Im Programmheft sind allerdings auch keine Rollen aufgeführt, nur die
Namen der vier Schauspieler. Die Zuordnungen rollieren, überdies müssen sie sich vieler Rollen
annehmen. Aufgeschrieben wäre das etwas unübersichtlich. Im Programmheft. Oder hier.
Dämonisches Begehren
K. sein: Jeder darf mal. Das Fluide passt zu unserer Zeit. Keine Festschreibungen. Es geht um
Strukturen, Mechanismen. Vor allem: Wie leicht wird in Träumen aus einer Figur eine andere. Wir
befinden uns in einem.
Im Haus eines Freundes musste Kafka im Durchgangszimmer an dessen schlafendem Vater
vorbei. Als der die Augen aufschlug, sagte Kafka höflich: „Betrachten Sie mich als Traum!“ Und
schlich weiter.
Stellt man sich diese von Max Brod überlieferte Anekdote vor, sieht man möglicherweise Buster
Keaton am Vater vorbeischleichen. Es gibt diese luziden, charmant blinzelnden Stellen bei Kafka,
die seine ausweglos labyrinthische Düsternis gegengewichten, auch im Prozess. Zum Beispiel
wird über Fräulein Bürster erst gesagt, dass sie oft lange im Theater ist. Als sie dann kommt,
besteht K. darauf, ihr seine Verhaftung vorzuspielen – wie im Theater.
Die Szene hat Regisseurin Jenke Nordalm drin in ihrer die Traumlogik akzentuierenden
Bühnenadaption. Und Witz auch, wenn auch weniger der luzide, sondern der des Grotesken,
Monströsen, Nachtgesichtigen. In diesem Fach hat Gilbert Mieroph nicht anders als grandios zu
nennende Auftritte, vor allem als wannenlägriger Advokat. Wie eine verzerrte Figur aus den
Bildern Francis Bacons schiebt und schleppt er sich voran.
Auch Nicolai Gonther lehrt einem später als Block das Fürchten – ohne dass man genau sagen
könnte, warum. Genau das ist vortrefflich. Und wie ein Mix aus den verquält gewundenen Welten
Bacons und dem erwähnt luziden Charme Kafkas turnen Julia Staufers Fräulein Bürster und Justin
Hibbelers K. einen verdreht anmutigen, erotisch aufgeladenen pas de deux, jeder für sich.
Fräulein Bürster ist dabei sehr korrekt gekleidet, aber mit Strapsen. Wenn es ein Moment gibt, das
diese Inszenierung akzentuiert, dann ist es ein alles grundierendes, dunkles Begehren, das
dämonisch Macht über die Menschen erlangt. Im Focus dieser Inszenierung steht vor allem K.s
eigenes Begehren. Dass sein Kuss ausgerechnet an Fräulein Bürsters Gurgel geht, ist kein Zufall.
Vor allem Justin Hibbeler spielt als Leni wie als Gerichtsdiener auf der Klaviatur der Lockungen.
Geschlecht und libidinöse Orientierung spielen dabei keine Rolle – durchdringen aber alles.
Wie Kafkas Roman führt auch diese Inszenierung auf die endlosen Flure der Ämter. Und in die
Strafkolonie, den Folterkeller – existierende Realitäten zumindest totalitärer Staaten. Wer ist
schuld? Immer der, der fragt, der zuschaut, der es sich vorstellt. Also K.
Per Video landet man auch in den engen Gassen der Tübinger Altstadt, die sich gut mit Vesna
Hiltmanns Dreh- und Verschiebeb&a
mp;uuml;hne in der Werkstatt verbinden. Daneben gibt es ein ums Eck
knickbares Treppenelement. Gänge und Stufen bei Kafka: Nach draußen, nach oben oder ganz
nach innen führen sie nie, nach endlosem Gehen strandet man beim Ausgangspunkt, der
seltsamerweise weiter vom Aus- oder Eingang entfernt liegt, nach allem Raufsteigen landet man
weiter unten – wie in den Bildern Giorgio de Chiricos.
Das Licht in der Werkstatt ist düster gedimmt, der Ton farblos fahl und grau, eine
Schwarzweißwelt, darauf hat man sich bei Kafka noch immer geeinigt. Man würde gern mal einen
ausweglos hell ausgeleuchteten Kafka in buntem Farbenspiel sehen, wie anders sähe die
Verdammung aus, wesentlich zeitgemäßer wohl. Und statt der Totenkopf-ähnlichen Fratzen, die
vermutlich der Gerichtsmaler da hingepinselt hat, könnte man Werbung, Propaganda, TV--Clips
strahlen – oder jene pornographischen Bilder, die K. in den Gerichtsakten entdeckt.
Aber reden wir nicht über eine andere Inszenierung. Sondern über diese, zum Beispiel über die
suggestiv leisen Töne, die Ulf Steinhauer dem Spiel manchmal unterlegt, ein ander Mal stampft er
laut drüber, schlägt zu wie der Prügler. Schöne Auf- und Abgänge: Hier lugt ein Kopf herein, dort
turnt Fräulein Bürster durchs Fenster, ist’s eine Fata Morgana oder echt? Schauen wir nochmal
hin: Der Kopf ist wieder verschwunden. Aber Fräulein Bürster hat sich inzwischen weiter ins
Zimmerinnere vorgeturnt.
Ein Millionstel durchgestanden
In der Gerichtsszene wird Publikumsgeräusch zugeschaltet. Showtime. Die Inszenierung hat, wie
der Roman, ihre theatralischen Seiten, Perlen, die Regisseurin Jenke Nordalm nicht vor die Säue
wirft sondern dem Publikum extremgepflegt serviert. Das gilt auch für die feineren Stellen. Es lohnt
sich immer, auch auf Jene zu schauen, die gerade nicht sprechen. Zum Beispiel auf K., als Block
von seinem eigenen, bereits Jahre währenden Prozess spricht: Entsetzt schlägt K. die Hände vors
Gesicht. Er hat soeben begriffen, welch Millionstel er erst durchgestanden haben könnte. Variation
einer von Kafka wiederholt („Kaiserliche Botschaft“, Türhüterparabel) durchgespielten
Vergeblichkeitsfigur.
Die Lesarten des Romans sind bekanntlich zahlreich. Vom Mensch in den Fängen
undurchschaubarer, totaler Bürokratie bis zur Parallele Urteilsvollstreckung/Tod. Manchen mag es
in der Pandemie so ähnlich gehen: Verhaftet. Alle Eingaben verpuffen. Alles unwirklich,
nimmerendend.
Reutlinger General-Anzeiger, 29. März 2021
Verloren in unwirklicher Bürokratie
(von Thomas Morawitzky)
Ein Spiel, das den Rand der Wirklichkeit bedrohlich weitet.
Man stelle sich vor, eines Morgens käme ein Mann ins Zimmer, den man dort noch niemals sah. Man stelle sich vor, eines Morgens würde man verhaftet. Franz Kafkas unvollendeter Roman »Der Prozess« gehört zu den bekanntesten Texten des 20. Jahrhunderts, vielfach interpretiert; er entstand zwischen 1914 und 1915, er rührt mit seinen Bildern einer endlos wuchernden, surrealen Bürokratie noch immer an existenzielle Ängste.
Das Landestheater Tübingen hat Kafkas Obsessionen nun eindringlich auf die Bühne gebracht. Jenke Nordalm, spezialisiert auch auf die Dramatisierung literarischer Vorlagen, hat ihre erdrückende Zwanghaftigkeit in Szene gesetzt: Bizarr, dunkel, ambivalent, nah am Original.
Nordalm hat darauf verzichtet, Kafkas Bilder der Gegenwart anzugleichen. Vesna Hiltmann schuf Kostüme, die aus einer gespenstischen Vergangenheit zu stammen scheinen. Ihr Bühnenbild ist in dunklen Grau- und Brauntönen gehalten: Der Ausblick auf einen aschgrauen Himmel, zerschnitten von Stromleitungen; eine Wand wie voller Rost, in der die schemenhaften Gesichter vieler Menschen schimmern; eine Wand, die eine Kreidetafel ist, auf die die Spieler hektisch Zeichen werfen werden. Erst steht auf ihr der Text der Türhüterlegende, die Kafka in seinen Roman aufnahm. Es gibt einen alten Heizkörper, ein Krankenhaustischchen, eine kahle Treppe findet sich nahebei. Die Bühne dreht sich, die Stationen des Alptraums entstehen: K.s Zimmer, der Sitzungssaal, die Kanzleien.
Zuerst spielt Justin Hibbeler den Josef K.: Ein junger Angestellter, zu Hause. Julia Staufer und Nicolai Gonther sind die Wächter, die ihn heimsuchen: Mit verstellten Bewegungsabläufen, mit zurückgestreckten Armen, vorgeschobenen Hüften, driften sie durch das Zimmer, wie seltsame Puppen oder verunglückte Animationen, boshaft, bedrohlich, unwirklich. Gilbert Mieroph ist noch Frau Grubach, K.s Vermieterin – mit aufgesetzten Brüsten und vergrößerter Mitte wiegt er sich in kokettierender Leibesfülle. Julia Staufer, mit Strumpfhaltern und Korsett, wird zu Fräulein Bürstner, die neugierige Versuchung von nebenan, die durchs Fenster zu Josef K. hereinsteigt.
Unmerklich, dann aber doch plötzlich ist der Moment da, in dem der Zuschauer entdeckt, dass die Schauspieler ihre Rollen getauscht haben: Nun ist Nicolai Gonther, kenntlich durch einen staubigen schwarzen Mantel, in Josef K.s Rolle geschlüpft. Später wird Julia Staufer der Angeklagte sein; ganz zuletzt, als K. sich auflehnt, wird Gilbert Mieroph ihn verkörpern. Die Wechsel erschließen sich zuerst über die Kostüme, Accessoires. Die Schauspieler bringen neue Facetten der Figur zur Geltung – die Vorsicht, Skepsis, Angst und Wut, die Verunsicherung und Verzweiflung. K.s Identität löst sich auf, gewinnt dann wieder an Kontur: Ein Spiel, das den Rand der Wirklichkeit bedrohlich weitet. »Sie sind kein besserer Mensch als ich«, sagt eine der Traumfiguren zu K. »Sie haben auch einen Prozess, Sie sind auch angeklagt.«
Hier in dieser Zwischenwelt werden Schuhe zu Hufen, stehen bunte Zirkuspodeste im Gerichtssaal, essen Angeklagte ihre Papiere, wälzt sich der Advokat Huld (Mieroph) nicht in einem Bett, sondern in einer alten Wanne. Ulf Steinhauers Musik trägt manches noch zur Wirkung dieser Szenen bei.
Als »Der Prozess« Premiere feiert, findet sich auch Petra Olschowski, Staatssekretärin im Landesministerium für Kunst und Wissenschaft, im Publikum. Gemeinsam mit Thorsten Weckherlin, dem Intendanten des LTT, eröffnet sie den Abend mit spürbarem Enthusiasmus für das zurückgekehrte Theater. Zumindest bis 18. April soll das »Tübinger Modell« mit geöffneter Kultur bei Schnelltestpflicht fürs Publikum weitergehen.