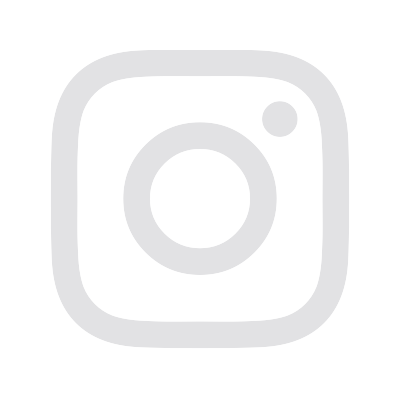Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.







nach dem Roman von José Saramago · Deutsch von Ray-Güde Mertin · 16+
Schwarzwälder Bote, 6. Oktober 2021
Brachiale Inszenierung in grellem Licht fordert
(von Christoph Holbein)
Premiere von „Die Stadt der Blinden“ / Publikum wird nicht verschont
„Ich glaube nicht, dass wir erblindet sind. Ich glaube, wir sind blind; Blinde, die sehen, Blinde, die sehend nicht sehen“: Die Inszenierung „Die Stadt der Blinden“ nach dem Roman von José Saramago in einer Fassung für das LTT von Dominik Günther, der auch Regie führt, erweist sich bei der Premiere in der Werkstatt des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT) als eine Arbeit mit hoher Brisanz und äußerst stringentem gesellschaftspolitischen Bezug auf die aktuelle Situation in Zeiten von Corona. Hinter einer Wand mit neblig-durchsichtiger Folie – Sandra Fox zeichnet für das Bühnenbild verantwortlich –, im immer wieder auflodernden blitzlichtartigen grellen Hell der Scheinwerfer und untermalt von Musik und stampfenden Tönen, für die Jörg Wockenfuß mit seinem Sounddesign sorgt, entwickelt sich ein von Wahnsinn und Eruptionen geprägtes Spiel des Ensembles, das durchweg eine starke Leistung offeriert. In dem Mikrokosmos - isoliert und hermetisch abgeschottet von der Außenwelt, um die Ansteckungsgefahr einzudämmen – kommt es unter den unmenschlichen Bedingungen zu Gewaltausbrüchen, Verteilungskämpfen um Lebensmittel, Vergewaltigungen und Mord, geht es um Regeln und Befehle und um das Pflichtbewusstsein der Bürger als ein Akt der Solidarität, die bald zerbricht, weil jeder sich selbst der Nächste ist. In dieser „Hölle“ bleibt die Frau des Augenarztes, die ihre Blindheit nur vortäuscht, ein Rettungsanker, eine stabile Größe, die einen Funken Hoffnung schenkt, als Sehende in einer demoralisierten Gesellschaft.
Regisseur Dominik Günther schont sein Publikum nicht. Die echauffierte Inszenierung strengt an. Alles ist aggressiv: die Sprache, das Handeln, die harte Musik – eine brachiale, ja brutale Regiearbeit. Das Ensemble dokumentiert eindrucksvoll die Hilflosigkeit der Blindheit und projiziert in der Kakophonie, im Spiel von Licht und Musik das Erschütternde, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft in einer Pandemie jede Maske der Mitmenschlichkeit fallen lässt, gegen alle Regeln der Humanität verstößt. Das fordert die Sinne der Zuschauer. Im Gestampfe, Gehopse, Geklapper des archaischen Spiels auf der Bühne interpretiert Günther den visionären, klaustrophobischen Roman von Saramago in einer eindrücklichen Tiefe und Schärfe, welche die Schauspieler mit ihrem Agieren plakativ ausloten. Die Angst, die Hoffnungslosigkeit sind spür- und greifbar – übersetzt in charakteristische Körperlichkeit der Protagonisten. Und die Bezüge zur aktuellen Lage sind offensichtlich, wenn das Fazit lautet, dass die Regierung überfordert ist und ihre Strategie ständig ändert. Alle sind mit Blindheit geschlagen und damit ihrer Einfühlsamkeit entleert, denn „die Augen sind der einzige Ort des Körpers, wo sich vielleicht noch die Seele befindet“. Bei aller tragödischen Schwere versteht es der Regisseur, einen gewissen leisen Witz einzustreuen. Die Szenen sind stark, die Sprache mitunter derb und gewalttätig. Die Würde kommt unter die Räder.
Der starke Beifall des Publikums am Schluss zeigt, dass die LTT-Inszenierung einen Nerv getroffen hat.
Reutlinger General-Anzeiger, 2. Oktober 2021
(von Thomas Morawitzky)
Das LTT zeigt »Die Stadt der Blinden« nach dem Roman von Literaturnobelpreisträger José Saramago
Ein Blitz, grelles Licht, und die Zuschauer in der Werkstatt des Tübinger Landestheaters finden sich, für Sekunden, in einem Zustand, der jenem gleicht, unter dem die Figuren des Stückes leiden: Geblendet, fast blind. Auch für den Rest der Vorstellung wird ihre Wahrnehmung des Bühnengeschehens verwischt sein, vage, unklar – bis auf einen schmalen Korridor, der sich in der Mitte auftut, an dessen Ende ein Spiegel steht, ist die gesamte Bühne verborgen hinter matt transparenten Stellwänden, die die Schauspieler in Schatten verwandeln, es sei denn, die Schauspieler treten nahe heran an die Wände und werden zu milchig bunten Gespenstern. Die Blicke der Zuschauer fallen, entsprechend ihrem Sitzplatz, in unterschiedlichen Winkeln durch die Öffnung der Mauer, nehmen klar immer nur einen Ausschnitt der Szene wahr, einer Welt, die aus den Fugen geht.
»Die Stadt der Blinden«, der berühmte Roman des portugiesischen Nobelpreisträgers José Saramago, erzählt von einer Epidemie, die Blindheit bringt, Chaos. Menschen verlieren ohne erkennbaren Grund ihr Augenlicht; die mit Blindheit Infizierten werden abgesondert, in Quarantäne gestellt, interniert, sind bald auf sich selbst angewiesen, während die Seuche um sich greift, die Menschheit zur Hilflosigkeit verdammt.
In Teilen lässt sich Saramagos 1995 erschienener Roman lesen wie eine Parabel auf die Gegenwart, und genau diese Parallele spielt Dominik Günthers Inszenierung am LTT aus – bewusst, aber ohne sie ins Polemische zu dehnen. Saramagos Roman wird in seiner Aussage nicht geschmälert, die Seuche bleibt ein Gleichnis für eine moralische Blindheit – aber »Die Stadt der Blinden« als Theaterstück am LTT ist nichtsdestotrotz eine Schocktherapie für pandemieerfahrenes Publikum. Jörg Wockenfuß’ Sounddesign, das unheilvolle Klänge, Techno und Attacken aus reinem Lärm und Echo in den Zuschauerraum schleudert, trägt keinen kleinen Teil dazu bei. Bald schon klingt auch die Stille nicht weniger bedrohlich.
Das Stück erzählt, von Anfang an, von Eingeschlossenen. Andreas Guglielmetti ist ein erblindeter Augenarzt, Susanne Weckerle seine Frau, die nicht blind ist, aber es zu sein vorgibt, um ihrem Mann in Quarantäne folgen und helfen zu können. Dennis Junge, Jennifer Kornprobst und Hannah Jaitner sind in der Tat erblindet; Gilbert Mieroph ist ein Dieb, ein alter Mann mit Augenklappe, der auf der Schwelle kauert. Sandra Fox gestaltete Bühne und Kostüme, ordnet die Figuren unterschiedlichen sozialen Feldern zu. Sie stehen für viele andere: Die Sprechstundenhilfe. Das Zimmermädchen.
Aber alle werden sie zu Schemen. Und dort, im Schattenreich, fallen die Grenzen, die Zivilisation und Barbarei trennen. Die Menschen verwandeln sich in Zerrbilder auf einer Leinwand, Gespenster, hilflose Ungeheuer. Wer die Quarantäne verlässt, wird erschossen; ärztliche Unterstützung gibt es nicht, die Eingeschlossenen sollen ihre eigenen Toten begraben. Aber täglich wird eine Kiste mit Verpflegung vor ihrem Gefängnis abgesetzt, die Blinden müssen die Vorräte selbst zu sich hereinholen. Die Soldaten höhnen, während ein Hungriger im Dunkel tappt: »Bist du blind, oder was?«
Bald schon sind auch die Soldaten blind. Verteilungskämpfe entbrennen. Bald gibt es Blinde, die Nahrung besitzen, und Blinde, die hungern. Die einen fordern von den anderen: Die Frauen. »Wenn ihr uns keine Frauen bringt, gibt es nichts zu essen.«
»Was würdet ihr tun, wenn sie statt Frauen Männer verlangten?«, fragt die junge Frau mit der Sonnenbrille, Hannah Jaitner, bitter. Sie steht in der Öffnung der Wand, klar umrissen, Gesicht und Arme zucken. »Was würdet ihr dann tun?« Dann tasten blinde Männer blinde Frauen ab: »Du taugst nichts, Nutte!«
Erzählt wird mit wechselnden Perspektiven – immer wieder ergreift ein anderer Darsteller ein Mikrofon, tritt aus dem Spiel heraus, berichtet. Zumeist kommt diese Rolle Susanne Weckerle zu, der Frau des Arztes, der einzig Sehenden. Fatalismus breitet sich aus unter den Blinden: »Nur wer sterben muss, wird sterben. Der Tod sucht sich die Menschen ohne Vorankündigung aus.«
Ob einer zuvor einen Tesla fuhr, ist plötzlich ganz egal. Der Unterschied zwischen drinnen und draußen existiert nicht mehr. Sechs Schauspieler zeigen 90 Minuten lang sehr stark Angst, Verzweiflung, Hass oder tanzen, wenn sie ihre Situation vergessen können, zur Musik von Lionel Richie. Zuletzt steht das Ensemble, das während der Vorstellung kaum je vollständig zu sehen war, in einer Reihe vor der Wand der Blindheit, denkt gemeinsam nach. »Es muss doch eine Regierung geben.« – »Ja, aber wenn, dann ist es eine Regierung von Blinden, die Blinde regieren wollen.« – »Dann gibt es keine Zukunft.« – »Jetzt geht es darum, zu erfahren, ob wir in dieser Gegenwart leben können.« Bei José Saramago kehrt das Augenlicht zuletzt zurück. Im Landestheater Tübingen bleibt das offen.
Schwäbisches Tagblatt, 2. Oktober 2021
Oh Mensch, du sehender Blinder
(von Peter Ertle)
Der Saisonauftakt „Die Stadt der Blinden“ am LTT geht trotz Pandemie-Aktualität gründlich schief. Ein Verriss.
Nein. Es beginnt schon mit der falschen Entscheidung, hier das Meiste hinter einer Milchglasfolie (Bühne: Sandra Fox) spielen zu lassen. Vielleicht weil Umberto Eco etwas über einen „milchigen Nebel“ schrieb? Dass Zuschauer, die nur Schemen sehen, selbst in die Welt von Blinden eintauchen, ist ein Irrtum. Dass so interessante Unschärfen entstehen, stimmt auch nicht. In José Saramagos Roman ist alles, was wichtig ist, deutlich. Im LTT-Stück auch. Aber halt nicht gut.
Story: Menschen erblinden, eine Epidemie, die Erblindeten werden interniert, von Soldaten bewacht, bei Fluchtversuch erschossen. Not, Elend, Verteilungskämpfe. Das ist das Thema. Hat man die aktuelle Pandemie vor Augen, ein Flüchtlingslager, ein Gefangenenlager, gibt es ein paar assoziative Parallelen, klar, aber das ist es dann auch. Um die Situation besser darzustellen, hätte es einen anderen als diesen Roman und vor allem ein anderes Theaterstück gebraucht.
Am LTT waren schon feine Stücke Dominik Günthers zu sehen und dass das Ensemble spielen kann, muss nicht erwähnt werden. Doch dieses Schauspiel hat bisweilen die Qualität von schlechtem Schülertheater. Ständig wird mit falschen Mitteln etwas behauptet, das sich nicht selbst transportiert. Die Erblindeten tapsen und stoßen sich dauernd demonstrativ an oder halten ihre Hand vor Augen, als müssten sie prüfen, ob da nicht doch was zu sehen ist. So wie in schlechtem Theater Besoffene immer sofort torkeln und lallen müssen.
Die Nerven zwischen den Inhaftierten liegen sofort blank, kaum eine Steigerung von sublim bis heftig. Aggression auf Brachialstufe, Zwischentöne oder Spannungsbögen? Fehlanzeige.
Mit Geräusch-und Hallkulissen soll Unheimlichkeit erzeugt werden, geisterhaft zeichnen sich die Schemen der Spieler als Schattentheater ab, Existenzialismus, so grell und expressiv wie zäh und bemüht, nichts packt einen. Schockhaft hellstes Zuschauerlicht dazwischen, Ohrfeigen für die Augen, ganz hinten ein Spiegel, wo man sich selbst sehen kann. Ja, wir alle sind gemeint, schon verstanden, wir sollen wachgerüttelt werden von diesem Stück. Oh Mensch!
Der gesamte Text des hochgelobten Autors ist in dieser Bühnenfassung bieder, völlig humorfrei, vermutlich ist die Lage einfach zu ernst, wenn nicht gar hoffnungslos. Die paar eingeschleusten Witze eines erblindeten Teslafahrers, dem sein inzwischen ebenfalls erblindeter Kollege das Auto geklaut hat, wirken dann wieder absolut deplatziert. Ein gemeinsames Singen der Inhaftierten ergreift nicht, wirkt nur lächerlich. Und wenn dann auch noch eine Gruppe männlicher Erblindeter sich über die weiblichen Erblindeten hermacht, wird’s ganz gruselig, aber klar, der Punkt Mann/Frau musste auch noch rein in dieses Dystopietheater, das sich dauernd mit Dramatik aufpumpt.
Wir kennen Flüchtlingslager, KZs, Archipel Gulag, Guantanamo, Sartre, Camus, Kafka, Beckett, wir haben soeben eine vergleichsweise sanfte Pandemie erlebt. Sagt uns „Die Stadt der Blinden“ etwas, das wir uns noch nicht vorstellen konnten? Oder das wir uns vorstellen konnten, auf glaubhaft-eindrückliche Weise? Nein. Nichts.