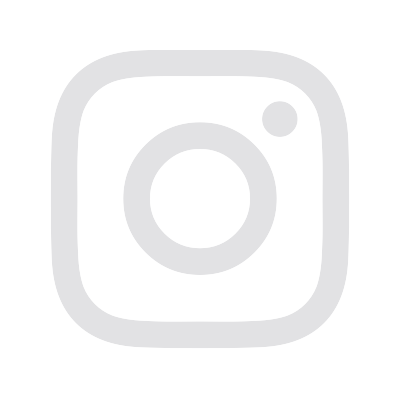Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.












Von Rocko Schamoni · Bühnenfassung von Dominik Günther · 14+
Reutlinger General-Anzeiger: „Dorfpunks“, 31. Dezember 2000
Rebellion mit Mofa und Dorfdisco
(von Achim Tennigkeit)
Rocko Schamonis Kultroman „Dorfpunks“ bringt Dominik Günther am LTT mit drei Darstellern auf die Bühne.
Schon der Einlass ist ungewöhnlich: Als die Zuschauer die LTT-Werkstatt betreten, spielt eine dreiköpfige Punkband – eher wie bei einer Probe als bei einem Konzert – laut, wild, hart und wenig inspiriert, den Rücken demonstrativ dem Publikum zugewandt. Nach ein paar Minuten, als alle ihre Plätze gefunden haben, dreht sich der Protagonist (Gilbert Mieroph), der eben noch das Schlagzeug traktiert hat, um und stellt sich vor: »Ich bin Punk. 1975 in England ausgebrochen, 1981 bei uns verebbt. Ein Jugendtsunami.« Er übernimmt die Erzählerrolle in diesem Stück, die im Buch der Ich-Erzähler Roddy Dangerblood inne hat, der mit 19 dann zu Rocko Schamoni wird.
Ein dramaturgischer Kniff, der aufgeht: Auf der Bühne werden aus einer Figur drei Akteure, zwei Männer (Mieroph, Justin Hibbeler) und eine Frau (Rosalba Salomon), die in den späten 1970er- und frühen 80er-Jahren in einem fiktiven 5.000-Einwohner-Dorf in Schleswig Holstein aufwachsen. Dort ist so gut wie nichts los, und der zugezogene Städter Roddy muss sich seinen Platz bei den Landjugendlichen erst erkämpfen.
Sein anfänglicher Hang zu Gewalt und Waffen manifestiert sich im latenten Tragen eines Soldatenhelms, er besitzt mehrere Messer und eine Armbrust. In einem zarten Anflug von Selbstkritik räsoniert der da Zwölfjährige, es gebe auf dem Land keinen Initiationsritus, deshalb müsse man sich die Rituale selbst ausdenken.
Die drei Kids klauen wie die Raben, nutzen den Famila-Markt als Kommunikationsort und treiben ihre derben Späße mit dem Ladendetektiv. Immer wieder schlüpfen die drei Akteure in neue Rollen und werden dann wieder zu Punks. Was sie verbindet, ist das Gefühl gähnender Leere, diffuser Angst und der Ablehnung der Erwachsenenwelt.
Das Bühnenbild besteht aus einer Drehscheibe, die die Schauspieler manuell zur Rotation bringen können. Darauf ein lang gezogener Ablagetisch, zu den Requisiten wie LPs und Musikinstrumenten kommt bald ein Mofa hinzu, das »das Scheißesein« erst mal beendet. Lautes und schnelles Durch-die-Gegend-Pesen sichert Anerkennung und Respekt, genau das, was die Jugendlichen suchen, deren Credo lautet: »Lasst uns irgendeine Scheiße machen!« Musik spielt weiter eine große Rolle.
Hits aus jener Zeit wie »Boys Don’t Cry« von The Cure werden eingespielt, die Handlung verlagert sich in die Dorfdisco Meiers, die für einige Zeit – auch in Ermangelung von Alternativen – »der Magnet in der Nacht« wird. Zum Vergnügen des Publikums übernimmt Roddy die Rolle des DJs.
Wenig später wacht er nach einem Besäufnis morgens im Bett in seinem Erbrochenen auf. Im Gegensatz zu Bon Scott, einem seiner Helden, ist er nicht tot und nicht daran erstickt. Mit einer Nagelschere stylt er sich jetzt auch optisch zum Punk um, was bei seiner Mutter Entsetzen auslöst, ihm bei den Gleichaltrigen aber einen coolen Ruf sichert.
Im Schüleraustausch geht es 1981 nach Poole und Bournemouth ins englische Mutterland der Punkbewegung. Doch die Hoffnung, echte englische Punks kennenzulernen, endet in krasser Desillusionierung. Auch ein Berlin-Trip, der meist im Stehen in zugezogenen Schlafsäcken erzählt wird, bringt nicht das, was man sich erhofft hat.
Zu »Riders on the Storm« setzen die Akteure Masken auf, fühlen sich als Loser, inszenieren ihren Selbsthass und bewegen sich kurzfristig auf suizidalem Terrain. Doch es bleibt eine Komödie, auch wenn nicht alle Pointen zünden. Der Klamauk nimmt zu, sorgt immer wieder für Gelächter. Dann wird es grotesk: 1983 setzen sich die drei riesige Sombreros auf und machen auf Schlager – Imagewandel total. Das Publikum klatscht heftig.
Roddy schmeißt die Schule und beginnt eine Töpferlehre. Nicht aus Überzeugung, aber sonst hätten seine Eltern ihn vor die Tür gesetzt. Zu den besten Momenten des Stücks gehört die Szene, als plötzlich Popstar David Bowie im Töpferladen auftaucht und sich von Roddy eine frisch geformte Vase wünscht. Schließlich erhält die Punkband die Chance, in Berlin aufzutreten. Doch schon ebbt die Punkwelle ab. Roddy alias Rocko bringt den Grund dafür so auf den Punkt: »Müdigkeit nach der Arbeit und der Aufbau von Nestern privater Zweisamkeit.« Lang anhaltender Applaus vom Premierenpublikum, das sich gut unterhalten gefühlt hat.
Schwäbisches Tagblatt, 30. November 2000
(von Moritz Siebert)
Das LTT zeigt „Dorfpunks“ nach dem Roman von Rocko Schamoni mit viel Lärm, mit Ironie und Nostalgie. Aber was ist vom Punk heute geblieben?
Schon bevor es losgeht, stampfen, schrammeln und grölen sich die drei mit Bass, Schlagzeug, Gitarre und drei Akkorden (oder waren es doch nur zwei?) den Frust von der Seele. So geht Punk. Sie sind Punk. Wir alle sind selbstverständlich irgendwie ein bisschen Punk, denn Punk ist ja nicht bloß ein Stück Kultur- und Musikgeschichte oder politische Haltung, sondern immer auch Sinnbild für jugendliche Rebellion und Selbstfindung, für Zweifel, Frust, Krise und Wut auf die Welt. Kann sich ja jeder noch erinnern.
Der Musiker, Autor, Schauspieler und Clubbesitzer Rocko Schamoni blickt in seinem 2004 erschienen Roman „Dorfpunks“ auf seine Jugend zurück und erzählt, wie die Punk-Welle Ende der 1970er-Jahre von England nach Deutschland schwappte und bis in die Provinz vordrang. Anderssein war im Dorf selbstverständlich auch damals nicht angesagt, in der Punk-Hochzeit zählte Schamoni aber immerhin 40 Punks in seinem Heimatdorf. Das Buch ist eine lose Aneinanderreihung von Erinnerungen, Szenen ohne zusammenhängende Handlung.
Das bietet gewisse Freiheiten für eine Bühnenadaption, weil viele Kapitel ziemlich beliebig übersprungen werden können, ohne die Geschichte zu zerstören. Das Fehlen einer stringenten Handlung stellt aber auch Herausforderungen. Dominik Günther, Oberspielleiter am LTT, hat den Stoff nun für die Bühne bearbeitet im Team mit Sandra Fox (Kostüme und Bühne). Günther verteilt die autobiografisch und retrospektiv erzählte Geschichte auf drei Figuren (Justin Hibbeler, Gilbert Mieroph und Rosalba Salomon), hält am Blick in die Vergangenheit und auch sonst stark an der Vorlage fest.
Die drei Akteure sind gleichberechtigt, sie erzählen, rutschen in Rollen, performen, tanzen und musizieren. Das passiert alles recht flüssig, die Szenen wechseln mal abrupt, mal greifen sie ineinander, manchmal verbinden Requisiten, oft die Musik. Die und der Lärm sind zentral: Das Trio ist mal Punkband, mal Maharaji-Band, mal Blockflötenensemble, Meilensteine der Punkmusik kommen von der Platte.
Auf der drehbaren Bühne ein Sammelsurium an Requisiten – selbstverständlich fehlen Punk-Utensilien wie Dosenbier und Schallplatten nicht. Das wirkt auf den ersten Blick stilecht anarchistisch und spontan, als ob einfach alles, was schon lange nicht mehr auf der Bühne war, mal wieder aus dem Depot durfte. Tatsächlich ist vieles davon durchdacht. Gegenstände, oft sind sie symbolisch, kehren wieder, verbinden Handlungsstränge. Erinnerungsfetzen geraten zu Collagen, die Inszenierung behilft sich auch mal mit Skinhead-Sockenpuppen und Kasperletheater.
Bei den Dorfpunks dreht sich viel um Mofas und Disko, um das Anderssein und vor allem um das Scheißesein. Sie verlassen ihre Heimat, trampen nach Berlin, wo sie auf ihre großen Vorbilder treffen, sie fahren nach England, wo sie schmerzlich erfahren müssen, dass ihre vermeintlichen Vorbilder längst einer anderer Subkultur anhängen. Und sie kehren immer wieder zurück nach Hause, an den Ort, an dem sie sich nicht selber darum kümmern müssen, dass das Essen auf dem Tisch steht.
Die Rastlosigkeit des Protagonisten, der Drang auszubrechen und das Scheitern daran vermitteln Hibbeler, Mieroph und Salomon sehr deutlich. Wie im Leben des Dorfpunks dreht sich auch das Leben auf der Bühne sehr schnell, aber eben doch nur im Kreis.
Es gelingt dem Stück in knappen zwei Stunden (bei zehn Sekunden Pause) die Essenz des Buchs pointiert auf die Bühne zu bringen. Den selbstironischen Blick Schamonis, auch auf schambelastete Jugenderinnerungen, greift Günther auf. Dazu gehört eben nicht nur die Punkwerdung, sondern auch ihr wenig ruhmvolles Ende: Das Projekt scheitert an Faulheit, Mangel an Zeit und „der Errichtung privater Nester der Zweisamkeit“. Tja, irgendwie gehört wohl auch das zum Punk.
Am Ende stellt sich dennoch die Frage, was ist denn nun von Punk geblieben? Gibt es das noch? Man hat in der LTT-Inszenierung schon die Ahnung, dass es hier nicht nur darum geht, an ein in der Vergangenheit liegendes Stück Kulturgeschichte erinnert zu werden. Der Kontrast von Perspektivlosigkeit und Tristesse auf der einen, Geschwindigkeit und rasantem Wechsel von Trends auf der anderen Seite, das kann man gut als universell lesen. Und doch wirkt der stete Blick zurück nostalgisch verklärend – und klebt stark an der betroffenen Generation.
Unterm Strich
Wie der Punk in die deutsche Provinz kam – und sie ziemlich unspektakulär wieder verlassen hat: Regisseur Dominik Günther hält sich in seiner Bühnenfassung von Rocko Schamonis „Dorfpunks“ stark an die Vorlage und verbindet die losen Szenen geschickt. Das sehr musikalische Trio um Justin Hibbeler, Gilbert Mieroph und Rosalba Salomon zeigt, dass es auch fähig ist, sehr unmusikalisch zu sein. In der Summe etwas viel Nostalgie – und zu wenig Suche nach dem Punk der Gegenwart.
Kritik Online-Portal cul-tu-re.de, 31. Oktober 2000
(von Martin Bernklau)
Ausgeheckt haben den Spaß Hausregisseur Dominik Günther und Ausstatterin Sandra Fox: die Geschichte des Punks, des deutschen Punks, des Punks vom Land zu erzählen. Günther hat „Dorfpunks“, den 2004 erschienenen Roman von Rocko Schamoni, mit dem Zusatz „im Dreierpack“, für die Bühne bearbeitet. Am Samstagabend war in einer ausverkauften LTT-Werkstatt Premiere. Zwar mag der Punk längst mausetot sein, aber da ist eine fantastisch frische, höchst lebendige, bildstarke und rasante Revue draus geworden.
„Ich war Punk, ich bin Punk“, schreibt Schamoni, ein künstlerisches Multitalent als Sänger, Schauspieler Schriftsteller, Moderator und nebenbei Club-Betreiber, am Anfang seines autobiografischen Romans, der nicht weniger will, als die Geschichte des Punk aus dieser besonderen Perspektive zu erzählen, aber auch aus den Resten der Erinnerung seine verlorene Kraft und seine toten Seelen erfassen.
Die Inszenierung von Dominik Günther packt den Punk als Dreierpack auf eine praktische Drehbühne und verteilt sie auf die drei Schultern von Rosalba Salomon, Justin Hibbeler und Haupterzähler Gilbert Mieroph, der vom Alter her ganz gut zu diesem Rückblick passt. Eine richtige Dramatisierung des Stoffs wurde es nicht, aber doch weit, weit mehr als bloß eine szenische Lesung.
Rocko Schamonis Ton ist bei allem drastischen Szene-Sprech fast schon bieder-bürgerlich, dabei aber eine durchaus flüssig elegante Prosa. Nur selten kippt er in das Deutsch der Soziologen, Psychologen oder Zeitkritiker. Die Protagonisten kippen dann mit. Das erzählende Imperfekt der Vorlage hielt das Trio die vollen zwei Stunden lang durch. Man gewöhnt sich dran, zumal die Inszenierung keine Behäbigkeit aufkommen lässt, sondern jede Episode mit möglichst viel Spektakel und szenischer Dichte auffüllt. Mit Lärm natürlich auch. Denn kein Punk ohne Musik. Viel vom Plattenteller, meist aber live.
Natürlich ist es dem 14-jährigen Lehrerssohn sterbenslangweilig im Dorf und der nahen Kleinstadt. Mofas, Mädchen, Meiers Dorfdisco, wo bis zum Abwinken abgetanzt wird, die im Familia-Markt geklauten Platten von Kiss und AC/DC, das Bier, der erste Rausch, sie machen den Anfang. In England geht seit ein paar Jahren der Punk ab. Irgendwann kommen die Erweckung und die Schere ans Haar. Mutter weint. Die schulischen Leistungen lassen nach.
Alles Rebellische der Achtundsechziger aber ist ausgelutscht. Da hilft nur noch die radikale, die Große Verweigerung: „Scheiße sein“, „No future!“, die Band und das Saufen bis ins Koma, palettenweise Hansa-Bier. Man mimt auch mal den Nazi, wenn’s zum Verschrecken der Spießer hilft, wie die Skins in England. hortet Waffen und trägt Stahlhelm. Auf dem Land hält ein Abgedrehter eine verfallene Villa, in der zu Hamburger Star-Club-Zeiten mal die Beatles übernachtet haben. Man geht ins Zentrum des Bürgerschreck-Bebens, nach London, trampt später nach Berlin zu den Toten Hosen, wo man mit Campino kumpelt und als Vorgruppe kläglich scheitert.
Da ist ein bisschen viel Promi-Dropping in der Vorlage. Sogar der abgewrackte David Bowie muss noch in der Landtöpferei vorbeischauen, wohin das Arbeitsamt den Protagonisten in die Lehre schickt. Aber sonst ist das Szenario schon erhellend, erinnernd und erkenntnisreich, zumal die schnorrenden und saufenden und völlig vermüllten Punks zeitenweise auch das Bild der Provinzmetropole Tübingen prägten.
Als Provokation wird mit „Roswitha“ sogar dem Schlager gehuldigt, als „Amigos“ unter Riesen-Sombreros Kohle gemacht mit musikalischem Müll. Das Publikum, das heutige, lässt sich anstecken von der abgerissenen, übermütigen Spielfreude, johlt, klatscht und macht sogar gerne mit beim Verticken der in Flaschen gefüllten Asche von Hitler, Stalin oder Jesus. So um 30, 40 Jahre später macht die Erinnerung uneingeschränkten Spaß. Und das ist gut.
Keine Sekunde Langeweile kommt auf bei dieser höchst unterhaltsamen Revue mit durchaus aufschlussreichem Rückblick auf eine rebellische Historie, die sich in Tattoos, Piercings und manchem Modetrend bei den Haaren irgendwann doch voll ins Normalo-Geschehen eingefügt hat. Aber der harte Kern bleibt Punk, „Forever Punk“. So heißt der letzte Song. Riesenjubel danach und langer Applaus für die drei Dorfpunks und das Team. Das Stück könnte in all seiner zwanglosen Beiläufigkeit ein richtiger Renner werden.