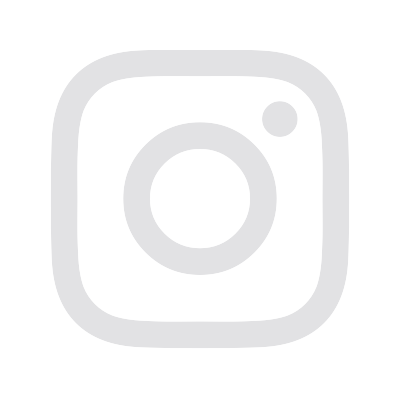Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.














Nach der Gothic Novel von Mary Shelley · 14+
Schwäbisches Tagblatt, 18. Juni 2024
(von Peter Ertle)
Wie der Praxisbeweis einer Theorie eine leidende Kreatur erschafft, zum Mörder macht und einen ehrgeizigen, aber verantwortungslosen Forscher böse einholt: Frankenstein am Landestheater.
Frankensteins Arbeitsplatz ist im LTT alles andere als ein Hig-Tech-Labor. Die Digitalisierung wird in irgendeiner Ecke mit einem betont alten Bildschirm plus Tastatur zitiert, sonst ist es eher Werkstatt, Rumpelkammer, Gartenhäuschen, etwas eigenartig, okay, irgendwo liegt eine Hand rum oder ein Gedärm, naj a so isses halt. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Nur der Goldglitzervorhang im Hintergrund bringt etwas anderes rein, macht den Ort zur Manege, zum Varieté der Zauberkunst.
Vielleicht gab es so eine Werkstatt auch in Lord Byrons Anwesen am Genfer See, wo der Hausherr im Sommer 1817 während stabil verregneter Tage seine Freunde zu einem Contest selbstgeschriebener und gegenseitig vorgelesener Schauerstücke einlud, den die „20-jährige Frau des englischen Romantikers Percy Bysshe Shelley“ gewann, wie eine Ausgabe von Kindlers Literaturlexikon weiß. Nun ja: Den Mann der Frau kennt heute eigentlich niemand mehr.
Mary Shelley nun weiß eine ganze Menge vom Menschen, kennt das Motiv des Zauberlehrlings, die Tücken der aus der Hand gegebenen, menschlichen Weiterungen, die heute mit dem Durchbruch der KI wieder so auf der Hand liegen, dass sie im LTT nicht extra bespielt werden, zu nah, zu offensichtlich, zu ernst. Shelley kennt auch unsere Liebesbedürftigkeit und die psychologischen Mechanismen der Ausgrenzungen. Und sie kennt die Dynamik von Forschergeist, Entgrenzungslust und Eitelkeit. Der Mensch tut immer, was er kann und weil er kann. Frankenstein will ja auch gar keinen Helfer oder Übermenschen, auch groß Geld zu verdienen, ist kein Thema. Er will in der Praxis beweisen, dass seine Theorie stimmt. Verantwortung für sein Geschöpf? Fehlanzeige. Risikoabwägung? Fällt ihm erst ein, nachdem sein Bruder (Jonas Hellenkemper) schon hingemurkst wurde und er sich von seiner Kreatur genötigt sieht, ein zweites Exemplar als Gefährten zu basteln.
Das Ganze ist sehr parodistisch, eine Art komisches Grusical, halb gesungen. Wenn Dominik Günther inszeniert, geht es meist in diese Richtung und meist nicht schlecht. Leo Schmidthals hat das Musikkostüm besorgt, aus den unterschiedlichsten Genres. Das letzte Lied zieht einem die Socken aus, so ergreifend ist diese Zwiesprache Frankenstein/Kreatur. Alle Lieder haben textlich diese kindliche Unschuld, als habe man improvisierend den erstbesten Einfall genommen, ohne zu glätten. Aber doch schräg ins Schwarze getroffen.
Und sonst: Adaptionen, Anspielungen, running gags wie das kü-hü-hünstliche Leben, von dem der Meister immer singsangt. Sein alter Lehrer Professor Waldmann (Gilbert Mieroph) reckt den Kopf durch den Vorhang und spricht wie ein Fisch, der im Aquarium das Plankton von der Scheibe rupft. Passagenweise hat das Revue-Charakter, wenn immer wieder die Eingangsmusik ertönt, die Schauspieler ihr frankensteiniadisches Tanzbesteck auspacken, oder sich wie auf einer Bauernguckkastenbühne mehrmals von rechts nach links verfolgen, um abermals rechts aufzutauchen. Oder sich Nachrichten hin und herschicken. Abschickungston: Schhhhb. Ankommenston: Bling.
Bei Rosalba Salomon (Frankensteins Geliebte Elisabeth) wundert man sich in jeder Inszenierung, wie präsent und anders sie wieder ist. Franziska Beyer erkennt man nach ein paar Minuten an ihrer Sprache. Als sie zum Applaus mit freigelegtem Privatkopf erscheint, stoßseufzt jemand: „Die Arme! Die wird froh sein!“ Als Ganzkörperkostüm eines hautlosen Fleisch- und Muskelpakets stampft sich ihre Kreatur durchs Stück, ungeliebt, einsam – gewinnt aber durch ihre Rolle, ihr Spiel eine dazu kontrastierende, große Zartheit und Verletzlichkeit. Der Regisseur hat ihr ein paar Hickser und Stöhner mit auf den Weg gegeben, Betriebsfehler neuer Technik.
Besonders grusliglustig ist das Geräusch brechenden Rückgrats ihrer Opfer, wenn die Kreatur mal wieder aus kraftstrotzender Ungeschicklichkeit falsch zupackt. Leid tut sie einem. Dennis Junge als Frankenstein erfüllt die junge Heldenrolle, die doch in so manchem auch die eines naiv losstürmenden Tollpatsch ist – wie auch großer Überheblichkeit, Missachtung.
Interessant: Auch seine Elisabeth will in dieser Inszenierung mehr von ihm haben, will leben, weg von diesem Forschungszeug. Da passt es, dass ausgerechnet sie neben dem Blinden die Einzige ist, die keine Angst vor der Kreatur hat – eben weil sie nicht ihr Äußeres, sondern ihr Inneres sieht. Wird aber auch – knack – weggemurkst, halb Versehen, halb Berechnung. Dieses Menschenporzellan ist aber auch sehr empfindlich, darfste gar nicht rankommen.
Der hiesige Oberbürgermeister würde jetzt vermutlich auf Facebook schreiben: „Schon wieder ein Angriff, immer das gleiche Muster. Ich habe es ja vor Jahren in meinem Buch schon prophezeit, damals wollte mir keiner glauben.“ Oder so.
In diesem Stück erwägt die Kreatur gleich selbst, zusammen mit einem erhofften, noch zu kreierenden Gefährten, auf eine einsame Insel auszuwandern, eine Art sicheres Drittland, könnte man sagen. Sachsen käme dafür nicht in Frage. Dort, in Ostdeutschland, fühlen sich ja offenbar auch viele als neue, ungeliebte Kreaturen und malen deshalb gern Monster an die Wand oder wählen entsprechend.
Sage keiner, diese unterhaltsame Revue hätte nichts mit uns zu tun.
Unterm Strich
Ein parodistisches Grusical mit mehr Komik als Grusel, aber auch mit jeder Menge Tragik und zeitloser Moral, die man sich in dieser Form gerne gefallen lässt – auf der Grundlage des alten Mary-Shelley-Stoffs, zigmal erzählt, verfilmt, parodiert, längst zum Klassiker geworden. Gute Unterhaltung!
Reutlinger General-Anzeiger, 16. Juni 2024
(von Thomas Morawitzky)
Das LTT bringt Mary Shelleys Horror-Klassiker »Frankenstein« mit Musical-Elementen auf die Bühne
Denkt man an Frankenstein, sein Monster, denkt man an Boris Karloff. James Whale machte ihn 1931 zur prototypischen Frankenstein-Figur – viele weitere Adaptionen folgten seither dem Muster, das hier vorgegeben wurde: Das Monster, aus geraubten Leichenteilen gebaut, wird in einem entlegenen Gemäuer durch den Blitz zum Leben erweckt, ist stumm, tötet in Verwirrung, wird von Dorfbewohnern gehetzt und verbrannt.
Nahe an der Vorlage
Wer einen Blick in das Buch wirft, das Mary Wollstonecraft Shelley 1818 anonym veröffentlichte, stellt fest, dass dort eine andere Geschichte erzählt wird. Shelley gab ihrem Monster Sprache, die Fähigkeit, seine sinnlose, schmerzliche Existenz zu artikulieren, seinen Schöpfer zu hinterfragen, ihn anzuklagen. Dominik Güthers »Frankenstein«-Inszenierung am Landestheater Tübingen beginnt als grotesk überdrehtes Musical, lässt die »Rocky Horror Picture Show« über den Gartenzaun schauen, hält sich zugleich aber erstaunlich eng an die Vorlage – und dringt vor zu ihrem Kern.
Die Show beginnt rasant und komisch. Dennis Junge stolziert als Frankenstein umher, sein Vater (Gilbert Mieroph) verdammt ihn zum Studium an einem obskuren Ort: »Ingolstadt!« Dort angekommen hört Frankenstein die Vorlesungen des Professor Waldmann (wieder Mieroph), der durch einen dreieckigen Schlitz im Vorhang schaut (ein Illuminat?) und lässt sich vom Studenten Clerval (Jonas Hellenkemper) die Idee einflüstern, dass elektrischer Strom Leben sei.
Leben aus dem Labor
Bald schon frohlockt Frankenstein als operettenhafter Geck: »Ich habe menschliches Leben erschaffen!« Doch das Experiment scheint misslungen. Frankenstein kehrt enttäuscht zu seiner Familie zurück. Im Labor jedoch beginnt die Kreatur, sich unter ihrer glänzenden Folie zu regen. Sie stolpert auf die Beine, sie beginnt, ihren Schöpfer zu verfolgen.
Sandra Fox schuf für »Frankenstein« eine Bühne wie ein Wimmelbild: Überall liegen Dinge, die auf Frankensteins Geschichte, seinen Mythos verweisen: Da ist ein Globus als Augapfel, da sind Trichter, Schläuche, eine Säge, Kabel, Tierpräparate, Instrumente, Herzen aus Stoff. Dazwischen Tastaturen: Denn Victor verkehrt mit seiner Verlobten Elisabeth (Rosalba Salomon) eifrig via E-Mail.
Das Kabuff des irren Wissenschaftlers gibt den Rahmen für alle Szenen des Stückes, ob sie nun in Ingolstadt oder Genf spielen. Frankenstein trabt im Eiltempo von hier nach dort, eine projizierte Landschaft fliegt vorbei, eine brutale Surfgitarre (musikalische Leitung: Leo Schmidhals) treibt ihn an. Beim ersten Auftritt schon tragen alle Schauspieler Horrormasken; Victors Familie gestikuliert mit künstlichen Gliedmaßen, sein Bruder William (ebenfalls Hellenkemper) tätschelt eine Alienfigur. Geht Frankenstein auf Reisen, stopft er einen Darm in seinen Koffer. Wo ist die Grenze? Wo endet der Mensch, beginnt das Monster?
Ein grotesker Körper
Das Monster auf der Bühne ist Franziska Beyer. Sandra Fox hat sie in ein fleischiges Ganzkörperkostüm gesteckt, das in alle Richtungen wuchert. Aus dem Innern des grotesken Gebildes kämpfen sich intensive Empfindungen an die Oberfläche, Fragen, Bedürfnisse. Gilbert Mieroph spielt dazu als blinder Mann ein Lied von Carole King auf der Gitarre: »You’ve got a friend«. Leider bleibt das ein Traum. Der Schritt über die Grenze ist schnell getan: Das Monster nimmt Elisabeth in seine Arme, bricht ihr das Genick und berichtet zugleich emotionslos von seiner Tat.
Dominik Günther hat einen Stoff, der berühmt genug ist, um gänzlich abgenutzt zu sein, als grelle Jahrmarktsensation inszeniert und damit ins Schwarze getroffen. Zuletzt sind das Monster und sein Schöpfer gemeinsam auf der Bühne – Frankenstein sitzt am Flügel, die Kreatur singt, blutrot in grünem Nebel. Beyers Stimme dringt traurig-schön aus dem entstellten Körper: »Ich sitze auf den Trümmern und weine über die Zerstörung. Liebe wird mir nimmermehr zuteil.«
cul-tu-re.de, 15. Juni 2024
(von Martin Bernklau)
Dominik Günther nimmt sich am Tübinger LTT das Horror-Urbild aus Mary Shelleys Schauerroman vor.
Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, den Regisseur Dominik Günther mit seiner LTT-Truppe da veranstaltet. Besser bebildert: auf dem Skalpell. Denn der „Frankenstein“, den er da nach Mary Shelleys epochemachender und stilbildender Gothic Novel inszeniert, ist alles in einem: Drama und Musical, Tragödie und Comedy, Parodie und Groteske. Ernste Scherze. Fast das Erstaunlichste dabei war am Freitagabend, dass es tatsächlich funktionierte.
Das Publikum – trotz unschlagbarer Fußballkonkurrenz gab es keine allzu großen Lücken auf den Rängen – schien mit seinen Erwartungen anfangs zwar verunsichert, feierte die Inszenierung am Ende aber in ziemlich einhelliger Begeisterung, auch wenn hier und da eine gewisse Ratlosigkeit übrig zu bleiben schien.
Die Britin Mary Shelley, eine damals noch sehr junge Frau und Dichtergattin aus künstlerisch-philosophischem Hause, hat mit ihrem 1819 zunächst anonym veröffentlichten Roman wie in einem Knoten alte und damals aktuelle Stränge – Alchimie und Hexenwahn, prometheischer Wissenschaftsglaube und Begeisterung über Naturphänomene wie Elektrizität – zusammengeführt und damit ein Genre begründet, dessen Fäden weitergesponnen wurden bis hin zu Dracula, der Rocky Horror Picture Show oder bis zur Welt des Harry Potter und der außerirdischen E.T.-Figur. Was übrigens Goethe angeht und dessen Homunkulus, der erst 13 Jahre später in eher beiläufiger Faust II-Rolle das Licht der literarischen Welt erblickte: Man wusste wohl voneinander.
Dominik Günther und sein Dramaturg Tom Gipfel haben nun eher weniger den (an der Illuminaten-Universität Ingolstadt forschenden) Menschenschöpfer Viktor Frankenstein mit seinem Allmachts-Wahn, seiner Angst und seiner Schuld ins Auge gefasst als vielmehr dessen Geschöpf, die namenlose „Kreatur“, die nicht einfach nur Horror und mit Donnerstimme gedoppelte Gefahr verkörpert, sondern endlich kein einsames Monster mehr sein und ein wirklicher Mensch werden will. Franziska Beyer stellt diese synthetische Gestalt trotz kraftraubender Vollvermummung in vielerlei Ausdrucksformen mit der Kontur einer empfindsamen Figur dar, fast eines komplexen Charakters in seinem Konflikt zwischen gewalttätiger Natur und menschlichem Nähebedürfnis. Große Klasse.
Ausstatterin Sandra Fox hat die Story und ihre Rollen nun in ein fürs LTT ganz ungewöhnliches Ambiente gepackt. Statt in hellen und weiten, durch edle Geometrie und kühne Perspektiven gefassten Räumen, lässt sie das Geschehen nur in einem beengten, meist düsteren Kammer-Kabuff des faustischen Forschers spielen, das sich allenfalls mal zum Flur der Familie Frankenstein öffnet, in dem dann Verlobungen gefeiert oder Morde begangen werden können.
Der Vorhang zum Rückraum öffnet sich eigentlich nur für zwei schöne Szenen: für das Lied des blinden, menschen-, aber eben auch monsterfreundlichen Sängers (Gilbert Mieroph) und für das finale Duett zwischen der Kreatur und ihrem Schöpfer Viktor Frankenstein (Dennis Junge) am Klavier. Von den vielen, auch mal ironisch anspielungsreichen Requisiten und Gesten, Zitaten und Verweisen, Michelangelos Adamsfinger zum Beispiel oder dem faustischen Totenschädel, ließen sich gewiss nicht alle von allen dechiffrieren.
Die Live-Musik zwischen Musical, Brecht-Weill-Song, Pop und Ballade hat Leo Schmidthals geschaffen, sehr passend, sehr ausdrucksstark. Selbst Rosa Salomon als elegante Frankenstein-Braut Elisabeth holt alles aus ihren stimmlichen Möglichkeiten heraus. Nicht für jeden leicht verdaulich wird es allerdings immer dann, wenn völlig ungebundene Prosa-Sprache mit einer Melodik unterlegt wird, die geradezu nach Rhythmisierung der Worte, wenn nicht sogar nach Reimen schreit. Da soll wohl provokant gegen den poppig-gefälligen Strich gebürstet werden. Was manchmal die Ohren mehr schmerzt als alle Blitze und Donner bei den reichlich, aber stimmig eingesetzten Effekten von Licht und Sound.
Rosalba Salomon und Jonas Hellenkämper (als jüngerer Frankenstein-Bruder) dürfen ihre Rollen über weite Passagen relativ naturalistisch geben. Auch Gilbert Mieroph schlüpft geschmeidig in seine vielen verschiedenen Nebenrollen und Kostüme dieser fantastischen Maskerade. Dennis Junge ist manchmal die Mühe anzumerken, seinen Viktor Frankenstein in fein austarierter Balance zwischen tragischer Figur, Stilisierung zum Typus oder einer Karikatur nah an der Comedy zu halten. Stellenweise gibt es Lacher im Publikum, wo sie eher unbeabsichtigt wirken.
Aber auch er schafft es, die scheinbaren Unvereinbarkeiten zu verbinden, die ganz verschiedenen Darstellungs- und Deutungsebenen der Inszenierung zu einer runden Sache zu drechseln, die fantastisch unterhaltsam und bildstark ist, aber auch zu vielerlei Gedanken und Assoziationen anregt über diesen ikonischen Schauerstoff, den Mary Shelley dem kulturellen und mythologischen Grundinventar der Menschheit beigefügt hat.