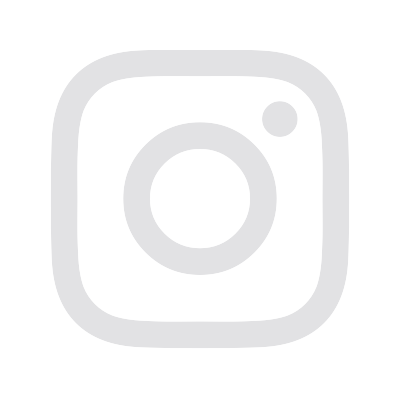Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.

Ein Abend über Paul Cézanne von Christiane Hercher und Andreas Guglielmetti
Reutlinger Nachrichten, 12. November 2014
(von Kathrin Kipp)
"Ich werde Paris mit einem Apfel erobern": Christiane Hercher und Andreas Guglielmetti zeigen im Tübinger Landestheater ihren Biografie- und Kunstmonolog über den französischen Maler Paul Cézanne.
(…) Der "Vater der Moderne", der als "Kopernikus der Malerei" eine "neue Weltanschauung" geprägt habe, wird aus den verschiedensten Perspektiven betrachtet, schließlich war ja Cézanne selbst ein Meister der multiplen Perspektive. Die Kunst- und Biografiecollage speist sich aus authentischem wie fiktivem Textmaterial, viel Kunstdoziererei und Vielstimmigkeit. Denn wie so oft in der Kunst haben auch hier alle eine Meinung - und jeder weiß es besser.
Und so dürfen hier auch alle mitreden: vom Kunstbanausen bis zum lieben Gott. Zwischen seinen Szenen und Figuren lässt sich Andreas Guglielmetti viel Zeit, wie sich auch der Entdecker der Langsamkeit Cézanne sehr viel Zeit beim Betrachten seiner Objekte gelassen hat.
So zieht sich die Diskussion ums unmittelbare Sehen versus Imagination, um die wahrhaftige Wahrnehmung, um die Schönheit und die Kunst der wertfreien Abbildung als roter Faden durchs Stück, wenn unter anderem Gott, ein verrückter Erzähler, versierte Kunstgenießer und kleingeistige Banausen, Cézanne selbst, seine Frau und spätere Kunst-Kapitalisten und Verkommerzialisierer sich in ihren Kunst- und Sehenstheorien versteigen.
Andreas Guglielmetti betreibt derweil im Malerkittel sein pedantisches Farbwesen, drapiert in immer neuen Variationen Äpfel, Krug und Faltenwurf des Tischtuchs. In einen schwarzen Vorhang gehüllt, spielt er die "göttliche Eingebung" oder posiert im weißen Leintuch als griechisches Schönheitsideal auf dem Tisch.
Er doziert wie ein Volkshochschullehrer über Cézannes revolutionäres Schaffen und animiert das Publikum zum aktiven Schauen: Wenn sie schon nicht als Nacktmodell den Abend sprengen wollen, sollen die Zuschauer wenigstens jetzt aufstehen, um an seiner klassischen Naturschönheit die Dreidimensionalität und die Linienlosigkeit der Natur zu bestaunen.
Das Tübinger Publikum bleibt träge sitzen, das Schönheitsideal ist enttäuscht: "In New York sind sie aufgestanden." Aber es weiß sich auch zu trösten: "Gut, Reutlingen gibt's ja auch noch."
(…) Cézanne selbst bleibt eine geheimnisvolle Collage aus verschiedensten Farbklecksen. Nur so viel will das Stück sagen: "Für die, die ihn wirklich lieben, bleibt er ein schwieriger Künstler." Seine Frau wiederum bilanziert: "So richtig froh ist er damit nicht geworden."
Schwäbisches Tagblatt, 3. November 2014
(von Peter Ertle)
Cézanne-Skizze mit den Mitteln des Theaters, unterhaltsames Einpersonenstück, das mit etwas Rollenspiel, glossierenden Schlaglichtern und leicht eingeschmuggelten Kunstreflexionen eine bewegte Kurzkomödie mit kontemplativen Momenten hintuscht.
(…) Der Abend (Mitarbeit: Christiane Hercher) hätte ganz schnell vorbei sein können. Nämlich dann, wenn sich eine Frau im Publikum bereit erklärt hätte, sich zu entkleiden und nackt auf der Bühne zu stehen, quasi als Real-Vergegenwärtigung von: Schönheit. Ob solch wortloser Schönheit zöge er sich nämlich zurück, sagte der Moderator. Ob das wohl mal passiert? Am Samstag passierte es wieder einmal nicht und so gab es das Einpersonenstück.
Eine Person. Aber viele Rollen: Cézanne, seine Frau, sein Vater, sein Sohn, allerlei Menschen aus dem heutigen Kunstbetrieb, auch aus dem damaligen. Haben wir einmal nicht sogar Gott gesehen? Sein Kopf ragte über einem Laken wie über Wolken hervor. Naja, sprechen wir einfach mal vom Schöpfer. Das passt dann auch auf den Künstler.
Das Laken ist eines der wenigen Requisiten, ein sehr wichtiges dazu: Faltenwerfendes Tuch auf dem Tisch, samt Äpfeln ein Stillleben. Dann Ehebetttuch. Dann Leinwand: Es ist die schönste Szene des Abends, wenn auf diesem Tuch nach und nach das berühmte Gemälde des Mont Sainte Victoire entsteht. Eines der Gemälde. Er hat den Berg ja wieder und wieder gemalt. Wie auch seine Frau. Wir sehen also Cézanne zu, wie seine Frau ihm Modell sitzt, geschickt gedoppelt, mal aus seiner, mal aus ihrer Perspektive. Eine harmonische Ehe sieht anders aus, überhaupt: Ein besonders netter, sympathischer Zeitgenosse war er nicht. Auch als Künstler hat er so manche Tiraden vom Stapel gelassen – aber eben auch sehr genaue Beobachtungen und Überlegungen zur Kunst, seiner Kunst, seiner Vision davon. Mit ihr war er seiner Zeit voraus, wurde er zu einem Übervater der malerischen Moderne.
Nicht die Linie, die Farbe zählt. Nicht der bekannte Gegenstand soll in den Blick, sondern der Moment, in dem wir vergessen, worum es sich handelt – und der Gegenstand solchermaßen neu entsteht. Nicht die eine Perspektive, sondern die vielen Perspektiven, die wir haben, sollen einfließen.
Zwei Perspektiven haben wir ja sowieso schon, je nachdem ob wir das linke Auge oder das rechte zukneifen. Genau darum bittet uns Guglielmetti einmal auch, in der Pose einer antiken Statue, eines schönen Körpers, das Laken diesmal als Handtuch um die Hüften gewickelt. Eine Schule des Sehens. Und, insgesamt: Eine Künstlerdokumentation mit den Mitteln des Theaters.
Lustig ist er schon auch, dieser Theaterabend. Es hagelt derbe Publikumsbeschimpfung, es gibt brachial gutgelaunte Amerikaner, dummdreiste Cézanne-Vermarkter, von Bewunderung zur eifersüchtigen Aggression wechselnde Cézanne-Kenner. Und was für eine schöne Sequenz, als Cézannes Frau über die damals noch ganz junge Kunst der Fotografie fremdelnd-bedenkenträgerisch räsoniert wie heute mancher über die Gefahren sozialer Netzwerke.
Nach dem Tod ihres Manns äußert sie, dass dieses ewige Pinseln für ihn keine reine Freude gewesen sein kann. Und wünscht ihm, dass er im Himmel nicht mehr malen müsse. Das ist komisch. Aber seit wann wäre Kunst die reine Freude? Oder anders gesagt: Zur reinen Freude und Entspanntheit gelangen zu wollen, ist ohne harte Arbeit und einer gewissen Verkrampfung nicht zu haben. Diese Paradoxie, unter anderem, nimmt der Zuschauer mit.
Das Mysterium Cézanne ist hingegen nicht zu greifen, allenfalls in Umrissen zu erahnen. Wäre auch etwas viel verlangt für einen unterhaltsamen Theaterabend, der mit Rollenspiel, glossierenden Schlaglichtern und leicht eingeschmuggelten Kunstreflexionen eine bewegte Kurzkomödie mit kontemplativen Momenten hintuscht. Die Skizze eines Künstlers, mit dem sich der ein oder andere danach eingehender befassen möchte. Und das ist ja schon viel.