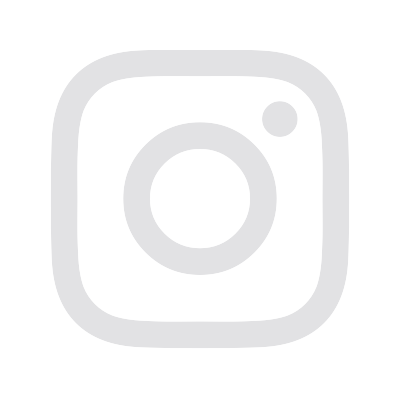Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.










nach dem Roman von John Steinbeck · Für die Bühne bearbeitet von Alice Buddeberg und Nina Steinhilber · Deutsch von Harry Kahn · 15+
Schwarzwälder Bote, 21. April 2022
Eine Welt voller Getriebenheit, Einsamkeit und Brutalität
(von Christoph Holbein)
Die Inszenierung von »Jenseits von Eden« zeichnet eine düstere Atmosphäre und drastische Szenen und das
Schauspieler-Ensemble besticht mit enormer Spielfreude und hoher Präsenz
»Jenseits von Eden« gedeihen Furcht und Angst, verschmähte Liebe und Eifersucht, rohe Sinnlichkeit und zerplatze Lebensträume, Gewalt und Krieg. Regisseur Jan Jochymski gelingt am Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT) mit seiner Inszenierung diese eruptive, düstere Atmosphäre des Romans von John Steinbeck in dichte, stimmige Bilder zu übersetzen. Entlang der Bühnenbearbeitung von Alice Buddeberg und Nina Steinhilber stellt Jochymski die große Frage nach dem Zwiespalt zwischen göttlicher Bestimmung und Schicksal auf der einen und freiem menschlichen Willen auf der anderen Seite.
Auf der Schräge, daneben ein Haufen mit Spielzeugpuppen – das Bühnenbild liefert Christiane Hercher –, entwickeln sich drastische Szenen. Das eben an der Brust gesäugte Baby in Form einer Plastikpuppe wird einfach weggeworfen. Pantomimisch auf Distanz kämpfen die Protagonisten sich nichts schenkend gegeneinander mit Fäusten und Füßen. Einer Puppe wird auf dem Holzklotz mit dem Beil der Kopf abgehackt: archaische Symbole einer rauen, gewaltvollen Welt voller Grausamkeiten.
Zum Teil im Chorus gesprochen ist das sprachlich gut erarbeitet und pointiert mit schönen Details im Spiel, feiner Mimik und immer wieder synchronen Bewegungen der Akteure. Intensiv werden die Bilder, wenn sich die Protagonisten in Zeitlupe über die Bühne bewegen – alles mit Musik, für die Marco De Haunt verantwortlich zeichnet, untermalt, das sind fast filmische Sequenzen. Eindrucksvoll sind auch die stillen Szenen. Glaubhaft ebenso die echauffierten auf die Spitze getriebenen Dialoge. Damit verdeutlicht die Inszenierung die Getriebenheit und Einsamkeit der Figuren, das Gehetztsein, fasst sie in aussagekräftige Bilder, die gut gesteigert, authentisch und glaubwürdig sind.
Zur Stimmigkeit trägt das Schauspieler-Ensemble bei, das mit enormer Spielfreude und hoher Präsenz besticht, allen voran Rolf Kindermann, der seine Rolle bis in die kleinsten Facetten auslebt, und Nicolai Gonther, der alle Nuancen auskostet. Das ist innige Schauspielkunst, die beredt den Konflikt auslotet, ob der Mensch eine Wahl hat oder sich seinem Schicksal ergeben muss.
Die Inszenierung – zumeist gemalt in düsteren Farben – komponiert feingliedrig und trifft die Stimmung von Steinbecks Roman. Aus dem Rahmen fällt das Ende, wenn zum Schlussbild alle gemeinsam – die Toten und die Lebenden – friedlich vereint am gedeckten Tisch sitzen und ein zusätzliches leeres Gedeck aufgelegt wird. Das symbolisiert ein glückliches Ende, obwohl es doch eigentlich gar kein gutes Ende geben darf – oder doch? Ein Schluss als Vision, biblische Utopie, Hoffnung, als Halt, Wunschtraum oder Wirklichkeit?: Mit dieser Frage entlässt die Inszenierung die Zuschauer in die Nacht und provoziert ein klein wenig Ratlosigkeit.
Schwäbisches Tagblatt, 14. April 2022
Die ewige Wiederkehr des Schlimmen
(von Peter Ertle)
Amerika, du hast es auch nicht besser: John Steinbecks „Jenseits von Eden“, ein beklemmender Wiederholungszwang familärer Schieflagen über Generationen hinweg, wird am LTT trotz Epilogs nicht hoffnungsvoller.
Zu Beginn, beim filmmusikalisch untermalten Blick auf die rötlich sandige Landschaft (Bühne: Christiane Hercher, Musik: Marco De Haunt), erwartet man einen Western. In gewisser Weise wird es auch einer. Männer kämpfen miteinander, und einer war im Krieg, wo er Indianer getötet hat. Das wars dann erst mal mit Western. Aber es steckt viel vom amerikanischen Gründungsmythos drin, vom frontier spirit, der Verheißung, man könne es schaffen, zumindest drüben, im Westen, where it never rains in southern California und die Samen so schnell aus der Erde sprießen, dass man wegspringen muss, weil es einem so schnell entgegenwächst. Doch es ist die verwunschene Spielart des american dream. Ein Albtraum.
Der Stoff der 1952 erschienenen, gewaltigen Familiensaga, bei deren Beschreibung meist einmal das Kain- & Abel-Motiv erwähnt wird (hiermit erledigt), lässt sich in einem allgemeineren Sinn auch als Menschheitsthema lesen. Flügge werden, Elternbeziehung als Päckchen dabei haben, Nest suchen, ein gutes Leben führen wollen, gut auch im moralischen Sinn. Scheitern. Warum nur macht der Mensch immer so viel Theater?
Und dies hier ist Theater, allegorisch, raffend und abstrakt: Wenn die Söhne miteinander kämpfen, sind es Luftkämpfe, die wir uns zu echten Kämpfen verlängern. Der Boden sieht wie eine Schräge mit künstlichen Kissen aus, rechts und links der Bühne ein großes A und ein großes C für die übermächtige Elternprägung. Wenn der ältere Adam und die ältere Cathy, die sich inzwischen Kate nennt, miteinander sprechen, gibt es filmisch oder fotografisch gesprochen fast Überblendungen zum jungen Adam, zur jungen Cathy, schnitttechnisch schnelle Wechsel. Später stehen auf ähnliche Weise zwei entfernte Generationen nah beieinander – durchaus leicht verwirrend für den Zuschauer, aber dramaturgisch sinnvoll, wiederholen sich die Motive doch über die Generationen hinweg. Dass Story und Realismus nicht unter der Künstlichkeit solcher Kunstgriffe leiden, ist der Fassung von Alice Buddeberg und Nina Steinhilber geschuldet. Jan Jochymski hat sie für Tübingen nochmal umstrukturiert, neu inszeniert: Manchmal sieht man die Schauspieler wie eine Armada im Slowmotion-Gang: Das ist der Marsch durch die Jahrhunderte.
Ein gutes Leben führen wollen: Für Kate gilt das nicht. Ob es die Gene sind oder Gott, ob man sie als biblische Verkörperung des Bösen sieht oder, wie bei Charles, einem im Vergleich zu seiner Mutter kleineren Tunichtgut, mangelnde Liebe seitens des Vaters (oder der Mutter) als Ursache vermutet, jedenfalls: Ein gefundenes Fressen für jede Schauspielerin, in diesem Fall für Sabine Weithöner, die diese sozialdarwinistische Femme fatale mit Sadismus, Laszivität, Ennui und größtmöglicher Kälte spielt. Inclusive Schreianfälle zum Erschauern. Und jetzt wissen wir auch, von wem Wim Wenders dieses (bei ihm charakterlich anders ausgeführte) „Paris, Texas“-Motiv hat, das Paar, die Frau, die wegläuft und dann als Prostituierte arbeitet, der Mann, der sie aufsucht.
Adam vereinigt ein gänzlich anderes, helleres, wenn auch von Verzweiflung durchzogenes Persönlichkeitsspektrum, das Rolf Kindermann eindrucksvoll darstellt. Der seine Söhne maßregelnde Vater; der seiner Frau trotz all ihrer Verfehlungen (sie schoss sogar auf ihn) Verfallene, sich dann von ihr Lösende. Immer trägt er diesen Gut/Böse-Kompass mit sich herum. Dass er als Pionier vor der Zeit mit einer später von anderen weltumspannend erfolgreich umgesetzten Idee auf die Nase fällt, wirkt wie Hohn. Armer Hiob.
Justin Hibbeler (in der berühmen Verfilmung Elia Kazans spielte seine Rolle James Dean) und Nicolai Gonther (zeigt zum dritten Mal in einer Inszenierung seinen blanken Hintern. Wette am Laufen?), die wir soeben noch in „Bunbury“ als famoses Paar sahen, werden am LTT allmählich so etwas wie das Duo Infernale, die Patentlösung für alle Freunde, Gegenspieler, Brüder, hier potenziert durch den Umstand, dass sie in Doppelrollen durch die Söhne-/Väter-Generationenfolge springen – und als Jüngere vieles erneut erleben müssen.
Ja, wenn es ein Zeichen der Hölle ist, dass sich alles Schlimme wiederholt – dann ist dies hier die Hölle: Der eine, Adam, zieht in den Krieg, nachdem er von seinem Bruder Charles im Streit fast erschlagen wurde. Der Nächste, Aron, zieht in den Krieg, nachdem er erfahren muss, dass seine Mutter eine Hure ist. Charles kommt mit seinem Geschenk beim Vater nicht an, Caleb eine Generation später ebenso. Ach: Abra, Arons Frau (Insa Jebens, Tübingens Antwort auf Tilda Swinton, spielt als Doppelrolle auch die junge Cathy), fühlt sich zum Bösewicht Caleb so hingezogen wie Cathy damals zum „bösen“ Charles. (Die sexuelle Attraktivität des Bösen, ein Dämon in dieser Saga.)
Die Inszenierung ist voller sichtbar gemachter innerer Vorgänge, sei es das Widerstehen Adams, als die alte Kate ihn noch einmal um die Finger wickeln will, oder Abras allmähliches Frontenwechseln von Aron zu Caleb. Ganze Filme hinter Calebs Hirnschale laufen ab, als der Vater sein Geschenk abweist. Arons Verstörung, nachdem er seine Mutter wiedergesehen hat, ist größer, als alle Worte es wiedergeben könnten.
Und immer ist dort, auf der Bühne, eine Grundstimmung des Entsetzens. Ein Berg nackter Puppen erinnert an grausame Geschichte. Beim Köpfen eines Huhns, an einer Puppe exerziert, würden heutzutage manche eine Triggerwarnung fordern. Im Moment mischt sich das im eigenen Kopf mit Bildern aus einem aktuellen Krieg im Osten. Das angeblich Gute interessiert mich nur, solange ich dadurch mehr erreichen kann als durch Macht, Täuschung und Gewalt: So agiert die amoralische Kate. Das Dumme ist, dass man in ihr auch eine nach (spekulativ:) schrecklichem Elternhaus und nachweisbar männlichem Gewaltübergriff rigoros auf Selbstbestimmung pochende, mit der Scheinmoral gleich auch die Moral über Bord werfende Seeräuber-Jenny sehen kann.
Nein, diese Inszenierung akzentuiert das nicht, doch gibt es ein anderes Schönreden, das schon in Steinbecks Roman steckt und hier nun als Happyend in pädagogisch-aufklärerischer Appellform draufgesetzt wird. Und genauso wirkt: aufgesetzt. Nämlich die Erkenntnis, dass jeder immer eine Wahl hat. Nett. Und falsch. Nicht mal im Rückblick hätte jeder immer eine gehabt. Richtig ist: Wir sollten eine haben und hätten viel öfter eine, als wir glauben. So viel Differenzierung ist fürs grob Plakative eines Stücks vermutlich unbrauchbar.
Unterm Strich
Feine, gut durchdachte Auslese und Modellierung des gewaltigen Stoffs. Düstere, beklemmende Grundstimmung, der am Ende perspektivisch etwas entgegengesetzt wird: Ein aus der Steinbeck-Apotheke geholtes und als Heilmittel ausgerufenes Pflaster für das große Weh dieses Stücks. Überakzentuiert. Weglassen!
Reutlinger General-Anzeiger, 12. April 2022
Erwachsenwerden mit biblischer Wucht
(von Thomas Morawitzky)
Sehr eindrucksvoll ist es, zu erleben, wie Jan Jochymski Steinbecks Epos zu einem Kammerspiel verdichtet, bei dem Emotionen hart aufeinanderprallen, bittere Wahrheiten ans Licht kommen, Götter stürzen, Illusionen zerbrechen.
Wie ein Keil, ein Splitter liegt die Landschaft auf der Bühne. Zwei kleine Hügel ragen auf, zwei Jungen laufen über sie hinweg, ein Mädchen spaziert vorbei. Und vorne, da stehen die viel Älteren: Die Frau mit dem harten Blick, der Mann. Ein großer Berg an Säuglingspuppen liegt dort, ein Berg an toten Kindern. Die Frau nimmt eine solche Puppe auf, wirft sie dem Mann zu, er fängt sie auf. »Jenseits von Eden« ist neben »Früchte des Zorns« der bekannteste Roman des US-amerikanischen Nobelpreisträgers John Steinbeck. Er lieferte zudem die Vorlage für einen der größten Hollywood-Erfolge der 1950er-Jahre: Elia Kazans Verfilmung des Stoffes machte James Dean zum Star. Kaum ein Jahr zehrte der Schauspieler von seinem Ruhm; mit 24 war Dean tot und Legende.
Nun spielt das Landestheater Tübingen »Jenseits von Eden« und Nicolai Gonther schlüpft in jene Rolle, die einst James Dean ausfüllte: ist Caleb, Sohn des Farmers Adam in Kalifornien vor rund 100 Jahren. Caleb wirkt ungeschlacht, ein wenig grob und wild. Aron, sein Zwillingsbruder, ist wohlerzogen, gehorsam, fromm – der Vater zieht ihn offenkundig vor. Bis es zu spät ist, bis Verstrickungen, die viele Jahre zurückliegen, zu einer Tragödie zu führen scheinen. Denn Kate, die Mutter von Caleb und Aron, ist nicht tot, wie Adam seinen Söhnen sagte – sie lebt in der nahen Stadt, betreibt ein Bordell, eine so rücksichtslose und kalte wie erfolgreiche Frau.
Elia Kazans Filmfassung konzentriert sich ganz auf den letzten Akt dieses Familiendramas; Jochymski, der »Jenseits von Eden« für das LTT inszenierte und sich dabei auf eine Bearbeitung stützte, die Alice Buddeberg und Nina Steinhilber 2015 für das Theater Bonn schufen, geht einen anderen Weg: Bei ihm überlappen sich Vergangenheit und Gegenwart. Der Effekt ist beunruhigend.
Nur Rolf Kindermann als der gealterte Adam, Sabine Weithöner als die gealterte Kate spielen Figuren, die in ihrer Zeitlichkeit deutlich festgelegt sind; Nicolai Gonther, Justin Hibbeler und Insa Jebens dagegen sind immer wieder beides zugleich: die eine Generation und die andere, die beiden Brüder Charles und Adam, die Söhne Caleb und Aron; Kate, die sich noch Cathy nennt, Abra, die noch unschuldig ist.
Kate war es, die frei sein wollte, die Adam in die Schulter schoss, die ihre Kinder abtreiben wollte, sich entschlossen abwand vom Guten; Adam ist es, der händeringend mit gepeinigtem Blick die heile Welt in ein Lot zu bringen versucht. Sie spielen auf der schiefen Ebene, jener Landschaft, die Christiane Hercher für die Tübinger Inszenierung schuf: Die allzeit gefährdete Existenz, unter deren Oberfläche die toten Säuglinge sich häufen. Sind die Kinder dazu verdammt, die Fehler ihrer Eltern zu wiederholen? Ist das Leben nur immer wiederkehrender Sündenfall? Gibt es keine Freiheit?
In einer letzten Szene will die Tübinger Inszenierung das Gegenteil behaupten: Da ist die Familie plötzlich geheilt, und auch der Sohn, der in den Krieg zog, ist heimgekehrt, alle sitzen am Tisch. Ein Versuch, die drückende Schwere der Vorlage aufzulösen, der ein wenig schlicht wirkt. Sehr eindrucksvoll ist es jedoch, zu erleben, wie Jan Jochymski zuvor Steinbecks Epos zu einem Kammerspiel verdichtet, bei dem Emotionen hart aufeinanderprallen, bittere Wahrheiten ans Licht kommen, Götter stürzen, Illusionen zerbrechen, der Existenzkampf der amerikanischen Farmer, die Zeitgeschichte und das Drama des begabten Kindes sich vermischen: »Nie wird die Welt des Kindes wieder h
eil und ganz«, sprechen die Schauspieler zu Beginn im Chor. »Großwerden ist mit Schmerzen verbunden.«
Die Eltern, Kate und Adam, sind in diesem Spiel die bestimmenden Figuren. Sabine Weithöner glänzt in ihrer Verbitterung, rebelliert gegen eine aufgezwungene Rolle, wird böse; Insa Jebens ist einmal die noch junge Cathy, die heiter davon erzählt, wie sie das Haus ihrer Eltern anzündete; dann ist sie die junge Abra, die zwischen den Hügeln umhergeht, sich zu den beiden so unterschiedlichen Söhnen Cathys hingezogen fühlt.
Die Musik von Marco De Haunt füllt viele Szenen mit schwellendem, staubigem Klang. Weit weg scheint er zu sein, der nicht mehr ganz so wilde, aber raue Westen, den Steinbeck beschrieb. Aber der Erste Weltkrieg steht dort vor der Tür. Wenn Adam von den Prüfungen der Soldaten spricht, wenn er sagt: »Kein Mensch hat genug Liebe«, dann wirkt diese archaische Welt erschreckend nahe.