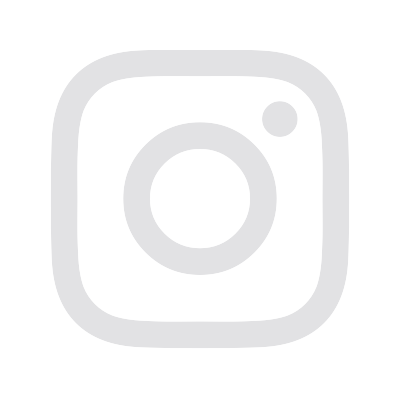Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.








Von Ivana Sokola · 15+
Reutlinger General-Anzeiger, 10. Februar 2024
(von Thomas Morawitzky)
Das LTT zeigt Ivana Sokolas preisgekröntes Stück »Kill Baby«: Klassisch streng, verbittert und in Pink
Die Tapete ist von dezenter Maserung, das Fenster geht ins Badezimmer, Vorhänge zu beiden Seiten, höchst adrett in hellem Pink. Es gibt drei weiße Plastikstühle und drei Frauen, beinahe ganz in Weiß: Nur die dritte, die jüngste, trägt ein Oberteil in gedecktem Ton zu ihrem weißen Kunststoffrock. Sie ist die Tochter, sie ist kein Kind mehr – ein entscheidendes Ereignis markiert das: Sie ist schwanger. Mit 17 Jahren, so, wie schon zuvor ihre Mutter, ihre Großmutter. Sie alle drei leben, ohne Mann, in einer Hochhaussiedlung, irgendwo auf halbem Weg zwischen Himmel und Erde. In beträchtlicher Fallhöhe also.
Ivana Sokola wurde 1995 in Hamburg geboren. Ihr Stück »Kill Baby« wurde 2021 am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt, erhielt im selben Jahr noch den Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Eine symbolhaft verdichtete Situation kommt hier auf die Bühne, eine Geschichte, die im Plattenbau spielt, aber in Ton und Haltung erzählt wird wie eine griechische Tragödie. Es geht um das Frauenleben, das sich immer wieder reproduziert, um die Mutter, die die Großmutter spiegelt, die Tochter, die die Mutter spiegeln sollte, eine Geschichte, die sich wiederholt, von Generation zu Generation. Immer wieder kommt ein junger Mann des Weges, schwängert, ist davon.
Susanne Weckerle spielt Sugar, die Großmutter, Franziska Beyer ist Viki, die Mutter, Solveig Eger ist Kitti, die Tochter. Sie leben in einer Puppenwohnung, in einem Puppenhaus. Und das beginnt zu sprechen. Manchmal meldet sich das Hochhaus zu Wort, poetisch, selbstbewusst: »Ich präge die Stadt. Ein Mann hat mich gemacht, und unter ihm viele Männer. Ich bin einer, der sich kümmert. Ein Vater, der feststeht.«
Die Stimme des Hochhauses scheint männlich zu sein; tatsächlich, dies erfährt man im Programmheft, gehört sie Solveig Eger. Zugleich hört man den Wind, und das Licht ändert sich. Um die Bühne fließt die Projektion einer Hausfront, lässt die Figuren im Innern nur noch kleiner wirken. Und unverkennbar ist diese Hausfront in Pink und Gelb, die da vorüberzieht, die eines Barbie-Puppenhauses: Der Kinohit mit Margot Robbie hat seine Spuren hinterlassen in Tübingen, als Popkultur-Zitat zwischen Feminismus und Kommerz – schon bei »Endstation Sehnsucht« griff man darauf zurück.
Katharina Grof schuf Bühne und Kostüme, die die wahrhaft existenzielle Frage, die im Mittelpunkt des Stückes steht, in ein triviales Idyll aus Kitsch und Künstlichkeit stellt. Die Frage: Soll das ungeborene Kind leben? Will Kitti es abtreiben? Wie die junge Frau diesen Gedanken hin und her wälzt und mit ihren leibhaften Vorgängerinnen in mitunter sehr rauem Ton diskutiert – das erzählt das Stück.
Darf Kitti das – die Kette unterbrechen, aus dem vorbestimmten Leben ausbrechen? Das Leben des Kindes gegen ihre Freiheit? Und: Welche Freiheit? Am Beginn des Stückes steht das Bild eines Lakens, das zwischen den Hochhäusern vom Wind von der Leine gerissen und davongeweht wird: »Es schwebt schwankend wie ein junger Geist zwischen den Blöcken den Bäumen entgegen, die stumm aushalten, um dann wieder aufgefangen zu werden und dahin geweht zu werden, wo wir nicht mehr sehen können.« Ein Körper, ein kleiner, menschlicher, ob nun der der Mutter oder des Kindes, kann das nicht: Er ist schon zu alt, zu schwer.
Solveig Eger, Franziska Beyer und Susanne Weckerle spielen, unter der Regie von Annika Schäfer, sehr körperlich. Sie kommen auf die Bühne, sie setzen sich zu dritt, übereinander, auf die noch gestapelten Stühle, sie fallen zu Boden, sie wälzen sich, strecken sich. Sie kneten einen Teigbatzen, reichen die Schüssel herum, sie füttern sich gegenseitig, sie wischen sich mit Spucke ab, sie flechten sich die Haare. Mutter und Großmutter spielen in der Badewanne hinter dem pinken Vorhang Abtreibung. Udo Jürgens’ Hit von 1984 »Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden« hängt als instrumentales Motiv in der Luft, ehe die drei Frauen es gemeinsam schlagerselig schön singen; auch Hildegard Knefs »Für mich soll’s rote Rosen regnen« wird gesungen – und natürlich: Es regnet rote Rosen auf der Bühne. Die wiederkehrenden Glücksversprechen.
Mutter und Großmutter scheinen in ihrem Leben längst erstarrt. Susanne Weckerle wirkt bitterer, Franziska Beyer weicher noch. Im Mittelpunkt steht Kitti, stehen die Verzweiflung, die Fragen, das Aufbegehren der jungen Frau, die sich schamhaft in die Ecke stellt, hinterm pinken Vorhang versteckt, die aufschreit und sich zu Boden wirft. Solveig Eger spielt sie eindringlich, nuanciert, legt unterschiedlichste Emotionen offen. Und »Kill Baby« wird zu einem sehr irritierenden Stück, mit seiner Überlagerung von kunstvoller Sprache, künstlichem Ambiente und bitterer Wirklichkeit.
Schwäbisches Tagblatt, 10. Februar 2024
Frauendreifaltigkeit im sprechenden Hochhaus
(von Peter Ertle)
Annika Schäfer lässt Ivana Sokolas „Kill Baby“ im LTT/Oben das tun, was dieses Stück auch will: Abheben – und gleichzeitig die Bleigewichte des Lebens nachzeichnen.
Erst kommt Kitti, die junge Frau (Solveig Eger), und setzt sich, dann Viki (Franziska Beyer), die Mutter, und setzt sich hinter Kitti. Dann Sugar (Susanne Weckerle), die Großmutter, und setzt sich hinter Viki. So könnte auch ein spätes Stück von Samuel Beckett losgehen. Alle auf einem Stuhl. Ein Mehrgenerationengesamtfrauenkörper. Dann ein kurzes Straffen, Zucken, Reißen nach oben. Später wiederholt sich bei einem anderen der vielen von Regisseurin Annika Schäfer geschaffenen Dreifraubildern dieser kurze Moment, dieser Stich ins Leben.
Der aktuell in diesem Stück verhandelte Stich ist die Schwangerschaft der 17-jährigen Kitti. Sie wohnt mit Mutter und Großmutter in einer zu kleinen Wohnung in einem Hochhaus. Frühe Schwangerschaft und vaterloses Aufwachsen ist hier generationsübergreifend das Gesetz. Letzteres muss nicht schlimm sein, aber in dieser offenbar lebensprekären Dreifrauklause ist es wohl längst zum Krisensymptom geworden.
Abtreiben oder nicht? Rein inhaltistisch focussiert könnte man dies als Hauptfrage des Stücks anführen. Oder auch: Vom Hochhaus springen oder nicht? Denn Kitti überlegt es sich, das Stück ist in die Kapitel 23 Meter, 16 Meter, 11 Meter, 3 Meter und Null Meter eingeteilt. Doch landete man mit solchen Inhaltsangaben weit daneben.
Vielmehr geht es um das Beziehungsgeflecht, ein Schicksalsporträt der Frauen, um die Vermessung einer psychosozialen, gesellschaftlichen Situation. Und zwar in einer hochpoetischen, lyrischen, bisweilen surrealen Sprache. Die Poesie verleiht dem Sozialdrama Flügel, mit dem es abheben kann. Auch das Hochhaus selbst spricht, die einzige Männerstimme, in gewisser Weise ja auch ein Phallus, so ein Hochhaus, vom Gemüt her hier allerdings eher eine Urmutter oder ein ersehnter Urdaddy, machen wir es kurz: Das Leben. Mit seiner bekannten Ambivalenz aus Fürsorglichkeit und kosmischen Kaltwinden, die dann auch hörbar durch das LTT/Oben heulen. Immer wenn das Hochhaus spricht, wird die Bühne von einem Video gerahmt. Dann wird der Guckkasten plastisch und bewegt sich wie ein Raumschiff. Phantastisch! Phantastisch auch die vielen Dreifraubewegtbilder, die Regisseurin Annika Schäfer schafft, ihre gesamte Bildsprache, man könnte ein schönes Album zum Durchblättern daraus machen.
Stellenweise Liebe und Zärtlichkeit steckt in der Beziehung dieser drei Frauen, daneben viel Ermüdung, Harnisch, Gemeinheit. Und immer wenn zu viel Verständlichkeit droht, haut Ivana Sokola wieder eine ihrer lyrisch-erratischen Sätze rein. Die auch mal nerven können mit ihrer verrätselten Art der Depositionierung. In den gelungenen Fällen aber ist es sprachspielerisch konkrete Poesie auf dem schmalen Grat zwischen Selbstversicherung und Selbstverunsicherung, manchmal analytisch scharf, etwa wenn Viki einem auf die Worte „gefreut hat“ endenden Satz mit einem „haben könnte“ und schließlich einem „hätte“ andere Endungen hinterherstottert.
Wenn sie eine Sonne wär, wär sie eine müde überm Meer, sagt Kitti einmal. Oder auch nur: „Wir stimmen doch nie.“ Solch wehmütig-existenzialistischen Einsprengsel bilden einen Hallraum von erschreckender Schönheit. Im Bühnenhintergrund, auf das sichtdienlich das Fenster führt, sehen wir dann eventuell ein kontrastierend krass unmissverständliches Abtreibungsgeschehen im Bad.
Der Teig, den Großmutter Sugar knetet, dürfte nicht nur für das Frauenlos Haushaltsarbeit (es wird auch gewischt) stehen, sondern symbolisch wohl auch für das, was in Kitti wächst – und für das gewaltsam geschmeidige, schicksalhafte Ineinanderverbacktwerden dieser drei Frauen, die hier alle bruchstückhaft von ihrem Leben, ihren Lieben, den Männern, erzählen, dem jeweiligen sozialen Druck, den festgefügten Rollenbildern und einer sich wiederholenden Unfähigkeit (oder einem Unwillen), sich zu binden. Dass in diesem Hochhaus auf einer oberen Etage eine familiäre Männergeneration wohnt und unten drei Frauen, ist symptomatisch für diese Welt, in der die Geschlechter verkrampft getrennt ihr Leben fristen, sich eine 17-Jährige als Wüste fühlt und ihren Lover als Kaktus.
Dass ihr das Stück da eine von Udo Jürgens geborgte „Liebe ohne Leid“ wünscht oder zumindest kontrastreich in den Raum stellt, nebst dem Knefschen Wunsch nach dem bekannten Regen roter Rosen – ist zwar verständlich, und fürs Publikum ein Zuckerle, aber eben doch ein Stilbruch. Das Stück wird sich untreu. Man könnte auch sagen: Die Untreue gehört zum Stück. Denn das Zuckerle findet man auch in den pinkfarbenen Vorhängen (Bühne, Kostüme: Katharina Grof) und dem Vornamen der Großmutter.
Und letztlich wird alles von der klaren und stilvollen Handschrift der Regisseurin zusammengehalten, ihren stimmigen Setzungen, Pausen und Lichtwechseln, dem der Poesie des Stücks Rechnung tragenden Sprechrhythmus, unaufdringlich, aber den Zuschauern an den entscheidenden Stellen auf die Pelle rückend.
Und, entscheidet sie sich am Schluss für die Abtreibung? Springt sie? Wir spoilern nicht. Was „Kill Baby“ auf jeden Fall ist: Ein theatralischer Zeitlupensprung, der Protagonistin Boden unter den Füßen verschaffend, so oder so. Und für den Zuschauer springt – ein Theaterstück dabei heraus.
Unterm Strich
Mit Mutter und Großmutter in einer Wohnung leben und dann mit 17 schwanger. Ein lyrischer Text, ein sozialrealistischer, dramatischer Inhalt, eine klare Bildsprache, drei überzeugende Schauspielerinnen. Durch die teils rätselhafte poetische Kunstsprache sicher nicht Jederfraus (und Jedermanns) Sache. Das ist „Kill Baby“. Ein Arthouse-Theaterabend, wie gemacht fürs LTT-Oben.
cul-tu-re.de, 9. Februar 2024
„Kill Baby“ im LTT – eine Frauensache
(von Martin Bernklau)
Das Tübinger Landestheater beginnt sein großes Premieren-Wochenende mit „Kill Baby“, einem sprachstarken Stück um Abtreibung.
Es ist ein Drei-Frauen-Stück, mit dem das LTT am Donnerstagabend in seinem kleinen Oberstübchen die zweite Hälfte der Saison begann. Und ein Drei-Generationen-Stück. Männer sind abwesend. Nur das Hochhaus, aus hartem Stahl und Beton, es spricht, als Stimme aus dem Off. Für „Kill Baby“ bekam die Dramatikerin Ivana Sokola 2021 den Kleist-Förderpreis. Das hat schon allein der Sprache wegen seine Richtigkeit.
Zwei blaue Striche und ein paar Tropfen Urin verändern alles. Kitti ist 17 und schwanger. Wohl von einem Nachbarn, nichts von Belang. Mit Mutter Viki und Großmutter Sugar lebt sie im zehnten Stockwerk, dem Himmel so nah – und der Erde auch: 23 Meter für einen entschlossenen Sprung. Ihr eigener Vater ist nach ihrer Geburt schnell verschwunden, der Opa gestorben, und dieser Mike mag für ein bisschen Liebe und ein bisschen Fürsorge auch kaum taugen. Kitti (Solveig Eger) will auf jeden Fall „alles in Ordnung bringen“. Zwölf Wochen Frist, „dann ist was einfach weggesegelt“.
Klar, sie wissen alles besser: Mama Viki – „Den Ficker habe ich doch gesehen!“ ruft Franziska Beyer – und die von Susanne Weckerle gespielte Oma Sugar, die verkündet, dass beim Großvater, vielleicht im Krieg geblieben, noch Beten helfen sollte. Beide früh Mütter geworden, jung Töchter bekommen, bald verlassen, mutterseelenallein mit dem Balg, ziemlich gelinkt vom Leben: „Kein Platz für keine von uns.“
Sie sagen das illusionslos nüchtern in dieser dichten Inszenierung von Annika Schäfer übrigens hin und wieder in jenem chorisch kategorischen Sprechen, das gerade voll im Tübinger Theatertrend liegt. Genau wie – speziell beim LTT – die Songs, die es hier auch wieder gibt: Von der „Liebe ohne Leiden“ singen sie später im Terzett, träumen mit Udo Jürgens oder mit Hildegard Knef vom besseren, vom glücklichen Leben. Es regnet rote Rosen, Mutter Viki wirft ihre Blätter wie Konfetti. Sie schießt aber auch mit Rosensträußen, in Cellophan eingepackt und zu Pfeilen umgebaut, auf eine Dart-Scheibe, die sich Susanne Weckerle schützend vors Gesicht hält.
Die drei Frauen hat Ausstatterin Katharina Grof in weiße Kittelschürzen gekleidet. Es könnten auch Arztkittel sein. Klinisch rein der Raum, drei weiße Klappstühle und die kalten Kacheln eines Badezimmers hinter dem Durchlass, der mit rosa Gardinen verhängt ist. Die können aber auch zum Einwickeln dienen, wenn frau sich einfach nur noch wegwünscht, sich verstecken oder einfach nur auflösen will. Das weiße Licht ist oft scharf und grell, gelegentlich grau gedeckt und immer wieder zwischen Kitsch und Klassen-oder Frauenkampf rosa bis pink gefärbt.
Der Text von Ivana Sokola ist in einem hohen Ton gehalten, nicht gerade Hexameter oder hymnischer Hölderlin, aber edel, elegisch – und doch offen für prolligen Slang. Solveig Eger, Franziska Beyer und Susanne Weckerle färben ihn dezent entlang ihrer Generationenrollen ein: Sugar mit einem Schuss an nostalgischem Pathos, Viki bisweilen abgebrüht vulgär und Kitti hin und wieder mit dem rohen Ton der Straße.
Sie schwankt: „Kind, wärst du mehr gewesen?“ fragt Kitti. „Wenn ich nur wollte…“, sinniert sie. Die Älteste faselt was von „unser Blut weitergeben“. Mutter Viki ist sich sicher: „Man hätte sich gefreut.“ Und die Stimme des (vielleicht symbolisch phallischen) Hochhauses raunt wie Heidegger oder der antikische Chor; „Da ist Gewächs.“ Im Hintergrund, im klinischen Kachelraum, in der Badewanne, da sind Sugar und Viki aber schon bei einer Abtreibung nach Engelmacherinnen-Art zugange. Kitti selbst scheut wohl auch die Kosten, weiß keine Adresse, will das Kind womöglich doch. Aber „ob sich das lohnt“, fragt sie sich.
„Nein, nein, nein! Nichts, nichts, nichts! Nie, nie, nie!“ entscheidet sie dann aber. Der Chor fällt ein. „Macht Platz für meine Zukunft! Kill Baby!“ beschließt sie. „Keine Chance, es kommt weg! Kill Baby!“ Einen ganz kleinen Spalt weit offen aber bleibt der Schluss dann doch noch: „Morgen Termin. Das Risiko muss man nicht eingehen. Null Meter“, macht sich Kitti Mut.
Eine Frauensache, ein reines Frauenstück. Ganz ohne zwanghaftes Transgender-Getue. Auch schon mal wohltuend, wo sich die streng wissenschaftliche Sicht, dass es wohl doch nur zwei Geschlechter gebe, inzwischen offenbar sogar bis in die Fußballstadien rumgesprochen hat.
Ganz großer, ganz langer Beifall.