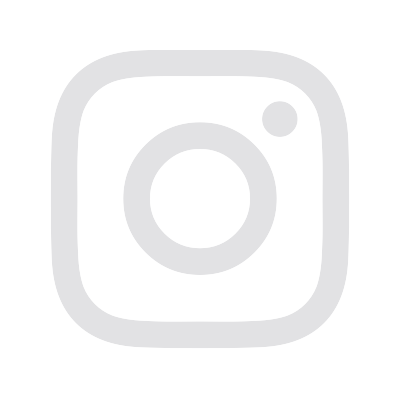Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.









Schauspiel von Friedrich Schiller
Schwäbisches Tagblatt, 29. Juni 2021
Sobald du willst, in jedem Augenblick, kannst du erproben, dass dein Wille frei ist. Versuchs!
(von Peter Ertle)
Das Weib ist nicht schwach, der Mensch als solcher vielleicht schon. Und wenn der Thronkonkurrentin auch noch die Herzen zufliegen, wird es halt schwierig. Das LTT nimmt Schillers „Maria Stuart“ auf leichte, verspielte Weise ernst.
Das Beil liegt schon da, hinten, im Horror-vacui-Weiß des Karzers (Bühne: Vinzenz Hegemann), während Staatssekretärin Davison in einem Vorspiel konkreter Poesie das Wollen und den Willen beugt. Ein bezeichnender Auftakt. Diese „Maria Stuart“ hat etwas nüchtern auf den harten Punkt Kommendes und etwas verspielt Drolliges, Verzerrtes. Plateausohlen heben Maria und Elisabeth in den Stand „hoher“ Frauen, im Verbund mit den Kostümen machen sie aus beiden auch Karikaturen, als hätte sich eine folkloristisch gestimmte Vivienne Westwood an ihnen versucht. Zwei Ritterinnen trauriger Gestalt.
Ja, traurig: Die eine, weil sie im Gefängnis – nein, nicht sitzt, sie steht immer. Die andere, weil ihr das Regieren eine Last ist. Und diese andere sitzt, sitzt aus und sitzt ein, anders gefangen. Was sich zum Beispiel darin äußert, dass ihr kein Stuhl recht ist. Insa Jebens gibt dieser zwischen merkelhafter Gefasstheit und missmutig unter der Last des Amts ächzender Queen so viel nonchalante Trockenheit, dass es eine wahre Freude ist.
The real match
Dass neben Davison auch noch Burleigh mit einer Frau besetzt ist und Mortimer bezopft und berockt daherkommt, ist Ausweis von Ensemblegerechtigkeit und Genderbewusstsein, tut aber weiter nichts zur Sache. Davison, Witzfigur des Stücks, spürt mit einem Beepbeepbeep-Metalldetektor das Geschmeide auf, mit dem Maria das Personal bestechen will, und Wächter Paulet (Rolf Kindermann), in ein langes Nachthemd gesteckt, darf zunächst mal alles, was er sagt, fünfmal wiederholen. Kurios. Da, ganz zu Beginn, fragt man sich kurz, wie aus dieser liebenswerten Klamotte Schillers Drama werden kann. Aber es wird.
Zweimal, als Maria redet, noch lange vor der tatsächlichen Begegnung der Rivalinnen, also in räumlicher Entfernung, im szenischen Off, steht Elisabeth entrüstet auf und geistert durch den Raum, bevor sie sich wieder setzt. Erst später kommt the real match, Burleigh vor dem alles entscheidenden Tennis-Aufschlag, Leicester gibt die entscheidenden Spielzüge im Schach durch. Es hebelt den Ernst der Sache nicht aus. Nur der falsche Ernst wird abserviert.
For the showdown
Etwas macht diese Inszenierung exakt so wie etliche andere Maria-Stuart-Inszenierungen der letzten Jahre – so weit wir den Überblick haben: Im Ansatz und dramaturgischen Drumherum liegt der Focus dieser Tage meist auf der Unfähigkeit, von der Macht lassen zu können. Eine strukturelle, politische, sozialhistorische, machtpsychologische Lesart. Dass Elisabeth als die schöne Junge gilt, dass Eifersucht zwischen den Frauen, dass Liebesränke ausschlaggebend sind, wird etwas weniger bespielt. Warum es geschieht, ist klar: Es passt nicht ins Frauenbild von heute. Nur: Wann fallen die Entscheidungen Elisabeths bei Schiller? 1) Nach der Begegnung mit Maria, gipfelnd im Satz: „Ihr verführt mir keinen mehr!“ und: „Das also sind die Reizungen, die ungestraft kein Mann erblickt!“ 2) Als Elisabeth bemerkt, dass ihr ehemaliger Liebling und Getreuer Leicester ihr Maria vorzieht.
Es geht also nicht nur um das Gefängnis der Sachzwänge oder Vorstellungen von Würde und Anspruch im politischen Sinn, es geht vielmehr um den Triumph des Persönlichen, Emotionalen, mit Eros und Eitelkeit Verknüpften, mindestens so sehr wie um das Recht und den Schutz der dort festgelegten Thronfolge, es geht auch um Stutenbissigkeit (pardon, können auch Männer: Putin/Nawalny – ohne Putins Machtmissbrauch und Nawalnys berechtigte Kritik daran zu unterschlagen), es geht um Gunst & Begehren, um Brittanys next Thrownmodel. Es geht auch darum, dass Burleigh, Leicester und angeblich eine Menge junger Männer sich aufmachen, die offenbar faszinierendere Maria zu befreien. Zum Beispiel der etwas tumbe, naive, allzu stürmische Mortimer (Justin Hibbeler) und der ungleich versierter verschlagene Pfau Leicester (Nicolai Gonther).
Die beiden geben schon bei Schiller kein starkes Männerbild ab. Aber „das Weib ist nicht schwach!“ Nein, aber vielleicht der Mensch als solcher. „Was ist der Mensch?“, wird hier wiederholt gefragt. Und: „Was ist das Glück dieser Erde?“ Ja, was ist es? Gerecht und gut zu leben, ohne Machtmissbrauch, ohne Schuld? Oder muss man nicht doch um jeden Preis geliebt, anerkannt, begehrt werden, und zwar mehr als die Konkurrentin, die einem das zu nehmen scheint?
Solche Fragen können einem in den Sinn kommen. Die Inszenierung kontert das weiterhin mit charmant komischem Understatement und Witz. Das Handy klingelt, Elisabeth ruft an. Mortimers Tod? Er fällt einfach nach hinten um. Das wars. Aber auch: Hannah Jaitners Witzfigur Davison vermag auf einmal ernsthaft Seelennöte zu vermitteln, als ihre Königin ihr das eben unterschriebene („Ich brauche jetzt den Stift!“) Todesurteil in die Hände legt. Schön!.
Der aufrechte Stratege Burleigh (Franziska Beyer) ist viel zu sehr tougher Tatmensch, um auch etwas von den komischen Brocken abzubekommen. Ach – und der so milde wie glasklare, melancholische, weise Shrewsbury wird in Konrad Mutschlers stiller Performance ein noch viel größerer Sympathieträger, als er es sowieso ist. „Sobald du willst, in jedem Augenblick, kannst du erproben, dass dein Wille frei ist. Versuchs!“ Wir hören, sehr deutlich, den Autor sprechen. Jenen Friedrich Schiller, der von den Gewaltexzessen und den immer neu für die jeweilige Situation und die jeweiligen Machthaber aufgestellten Gesetzen der Französischen Revolution entsetzt war. Das 16. Jahrhundert in England diente ihm vor allem als Kulisse.
Lonely on the top
Julia Staufers Maria hat ihre großen Momente in ihren rhetorisch glänzenden, Kenntnis über das englische Recht beweisenden Reden. Elisabeth verspielt den Kredit der Amtslast mit ihrer deutlichen Eifersucht, der Unterschrift und der Kunst, ihre Schuld feige abzuwälzen. Alles das muss so sein in einer „Maria Stuart“-Inszenierung.
So um die 25 sei Maria seiner Vorstellung nach, hat Schiller einmal bekundet. „Twenty-five years and my life is still / Trying to get that great big hill / of hope For a destination, / And I realized quickly when I knew I should / That the world was made up of this brotherhood / of man for whatever that means“, singt Maria am Ende in ihrem Kerker, und lauter, kräftiger: „And I say: hey yeah yeaaah yea yea hey yeah yea I said hey, what’s going on?“ Da kommt dann doch einmal etwas Pathos und Gänsehaut auf. Denn wir wissen: Irgendwo da oben, draußen wartet jetzt dieses Beil. Dann ist Maria weg. Alle sind weg. Außer Elisabeth, die alles von der Bühne kickt. Lonely on the top. Ist es ein Lehrstück? Und was lernen wir daraus?
Unterm Strich
Juliane Kanns Inszenierung ist leicht, konzis, witzig, weiß, worauf es ankommt, nimmt sich nicht zu ernst, ohne die Gewichte des Dramas zu unterschlagen. [...]
Schwarzwälder Bote, 28. Juni 2021
Sicheres Balancieren auf schmalem Grat
(von Christoph Holbein)
Landestheater Tübingen präsentiert erfrischend kreative Inszenierung von Schillers „Maria Stuart“
Es ist ein Balanceakt, den Regisseurin Juliane Kann mit ihrer Inszenierung wagt, ein Wandeln auf dem schmalen Grat zwischen tragischem Geschehen und komischer Attitüde. Das ist äußerst mutig, und das Wagnis gelingt: Die Regiearbeit zu Friedrich Schillers Werk „Maria Stuart“ am Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT) stürzt nicht ab. Sie verliert sich nicht im sinnfreien, aufgesetzten Klamauk nur um des Effektes Willen, sondern tariert die kreativen Möglichkeiten des Theaters gekonnt und den Nerv treffend aus. Juliane Kann kreiert damit einen ernsthaften wie vergnüglichen Premierenabend, eine starke Inszenierung, die bis zum Ende schlüssig bleibt, stimmig und authentisch - ohne falschen Pathos und ohne übertriebene Lächerlichkeit und Clownerie. Eine Inszenierung, die nicht abdriftet, sondern Demut gegenüber dem Schillerschen Text zeigt und dennoch gut gespielte eigene Akzente setzt.
Auf der kahlen Bühne mit ihrem aufgeschnittenen, offenen, halben Kubus, die, gestaltet von Vinzenz Hegemann, nicht mehr als ein paar Accessoires benötigt wie Klappstühle und eine zunächst im Spot liegende Axt, haben die Schauspieler, die zu Beginn in der ersten Zuschauerreihe des LTT-Saales sitzen und dorthin auch immer wieder zurückkehren, Raum, sich zu entfalten. Stimmig zum Bild tragen auch die Kostüme bei in ihrer Mischung zwischen klassisch, alltäglich und poppig, die passend die Protagonisten charakterisieren. Zwischen Musik, Tanzeinlagen und witzigen Details geht Schillers Sprache nicht verloren. Am Rande der Bühne liegt ein Damespiel auf dem Boden, bei dem die Protagonisten immer wieder Züge machen und Steine vom Brett entfernen. Das Licht wechselt, einer spielt Tennis an die Bühnenwand, Klappstühle werden auf- und zugeklappt: Regisseurin Kann streut auch ein bisschen Theaterpädagogik ein, lässt ihre Protagonisten in den kraftvollen Dialogen auch immer wieder alltäglich interpretieren und wirken. Das bricht die Ernsthaftigkeit und verleiht dem tragischen Geschehen eine komödiantische Nuance. Die Schauspieler tragen mit ihrem lebendigen, vielsagenden Agieren zum Gelingen bei: Konrad Mutschler gestaltet die Figur des Shrewsbury angenehm tiefgründig, Franziska Beyer gibt einen glaubhaften Burleigh, Insa Jebens überzeugt als Elisabeth - und vor allem Julia Staufer zelebriert mit großer Stärke und Intensität ihre Maria Stuart. Nicolai Gonther, Rolf Kindermann und Justin Hibbeler vervollständigen mit ihrem Spiel das runde Bild, und Hannah Jaitner setzt in ihrer köstlichen Rolle als fast hofnärrisch gezeichneter Davison dem Ganzen die funkelnde Krone auf.
Es sind diese Pointierungen - wenn Elisabeth auf keinem Stuhl länger bequem sitzen kann, wenn die Figuren immer wieder in die Alltagssprache ausbrechen, wenn sie sich entlang der Bühnenwand hangeln, wenn leichte Musik die Tragödie untermalt, wenn die Protagonisten zwischen klassischer Ernsthaftigkeit und burlesker Fröhlichkeit wechseln - die die Inszenierung interessant und lebendig machen, die den Raum geben für starke Szenen und die Handelnden menschlich und nahbar werden lassen, wenn am Ende die Frage bleibt: „Was ist der Mensch? Was ist das Glück der Erde?“
Reutlinger General-Anzeiger, 28. Juni 2021
(von Thomas Morawitzky)
Das LTT zeigt Friedrich Schillers Historiendrama »Maria Stuart« als grellen Tanz des freien Willens
Ganz am Anfang schon liegt auf der noch leeren Bühne im Lichtkegel die Axt: Spaltung, drohendes Todesurteil, konkrete Gewalt. Viel später ist es Maria Stuart, die diese Axt aufnimmt, in ihrer Ecke steht, während Elisabeth, die Königin von England, das Urteil fällt.
Juliane Kann hat Friedrich Schillers Tragödie um die beiden historischen Frauenfiguren am Landestheater Tübingen mit hintergründigem Humor inszeniert. Obschon, was hier verhandelt wird, durchaus nicht komisch ist, steigt in den Zuschauerreihen nicht selten ein Kichern auf. Metaphern des Spiels überlagern das Stück: Vinzenz Hegemann schuf eine Bühne, die ein sportliches Spielfeld darstellen könnte, mit abgerundeten Ecken – weiße Wände, vor denen man manchmal mit Schlägern und Bällen auf die Königin von Schottland schießt.
Der Hofstaat wurde von der Regisseurin selbst kurios gekleidet in kurze Hosen, Röcke, Krawatten, ein schmales, bodenlanges Kleid (Rolf Kindermann als Paulet, Ritter und Hüter der Maria), ein pfauenäugiges Jackett (Nicolai Gonther als Leicester). Hannah Jaitner in der Rolle des Staatssekretärs Wilhelm Davison schleppt Ordner umher, vermerkt mit »Akte Stuart«. Der Graf von Shrewsbury trägt Blouson und Schirmmütze; Mortimer (Justin Hibbeler), Paulets Neffe, der die Stuart befreien möchte, steckt in einer Bomberjacke und späht durch spärliches Gebüsch. Franziska Beyer spielt den Großschatzmeister Burleigh.
Dieses Personal lagert zuseiten der hell ausgeleuchteten Spielfläche. Dort gibt es auch ein Brettspiel, Dame natürlich, dort steht ein Piano, steht eine Flasche Schampus mit Gläsern bereit. Spricht man mit Frankreich, greift man zum Mobiltelefon. Wer stirbt, fällt um und wird davongeschleift. Das Leben ist ein Spiel mit tödlichem Ausgang.
Maria Stuart floh aus Schottland, angeklagt, die Schuld am Tode ihres Gatten zu tragen. Sie hofft auf den Schutz Elisabeths, aber die Königin muss um ihre Krone fürchten, auf die auch Stuart Anspruch erhebt. Die Berater fordern Maria Stuarts Tod – aber Elisabeth zögert.
Insa Jebens spielt am LTT die englische Königin, Julia Staufer ihren Gegenpart Maria Stuart in ihrer Gefängnisecke, das Gesicht oft zur Wand, den Rücken zur Welt, fordernd, anklagend. Ein Treffen der beiden Frauen, arrangiert von Leicester, bringt die Entscheidung: Maria Stuart gibt sich nicht versöhnlich, es kommt zur Eskalation. Noch zuletzt will Elisabeth sich der Verantwortung für das Todesurteil entziehen. Auch dies misslingt.
Schiller verhandelte in »Maria Stuart« Fragen der Ästhetik, Politik, Glaubwürdigkeit – Juliane Kann inszeniert sein Stück am Rande des Absurden als einen grellen Tanz, in dem es um den freien Willen des Menschen geht. Während Stuart unnachgiebig bleibt in ihrem Ressentiment, ist es Elisabeth, die sich hier wandelt, ihre zwiespältige Rolle erst annimmt, zum Mittelpunkt wird.
Insa Jebens spielt diese Wandlung nuanciert, mit zurückhaltender Eindringlichkeit: Die Königin, die erst noch abwartend auftritt, noch weich und nachgiebig wirkt, sich dann zur unwiderruflichen Entscheidung durchringt, die auch ihr Leben bestimmen wird. Bevor Maria Stuart stirbt, tobt sie und singt im Scheinwerferlicht einen Hit aus den 1990er-Jahren: »I pray every day for Revolution.«
Als Elisabeth zuletzt ihren Thron – einen Klappstuhl – in die Mitte der Bühne rückt, im grellen Licht, und sagt: »Jetzt endlich hab’ ich Raum auf dieser Erde« – ist sie Siegerin und Verliererin zugleich. Den Applaus nimmt das Ensemble in geordneter Aufstellung entgegen – wie Figuren auf einem Spielbrett. Friedrich Schillers Spiel mit zwei Damen wird am LTT zu einer wohlkalkulierten Farce, deren Ernst langsam und bitter hervortritt.