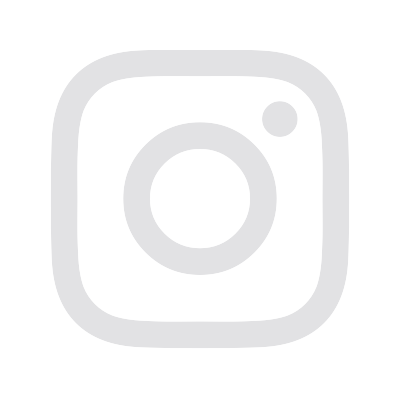Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.












Bürgerliches Trauerspiel von Gotthold Ephraim Lessing
Schwäbisches Tagblatt, 23. Februar 2015
Das Leben ist ein stürmisches Dreizimmerhotel
(von Peter Ertle)
Miss Sara Sampson am LTT: Liebeskonflikte, Seelenunheil, zwei Tote, zu späte Versöhnung - und gute Unterhaltung
Bei der Premiere von Miss Sara Sampson 1755 zerfloss das Publikum in Tränen, weil es zum ersten Mal nicht höfische Intrigen aus Frankreich oder Heldenverstrickungen aus der Antike, sondern sich selbst, seine eigene Gefühlswelt ernst genommen und eines Dramas für Wert befunden sah. Um das zu erreichen, hatte der Autor Gotthold Ephraim Lessing in einer künstlerbiographisch etwas zu frühen Phase auch richtig viel und für den heutigen Geschmack zu viel des Guten getan. "Miss Sara Sampson" gilt inzwischen mehr als Stück für die Theatergeschichtsschreibung als für die heutige Bühne. Das stimmt sicher tendenziell. Und kann im Einzelfall doch widerlegt werden. Die aktuelle LTT-Inszenierung ist dafür ein schönes Beispiel.
Nicht die Mutter,die Tochter mordet
Großartig schon das Bühnenbild von Sandra Fox, die die Einheit von Ort und Zeit auf die Simultanspitze treibt. Blick in drei Hotelzimmer, respective drei Betten. In der Mitte halten sich die junge, tugendhafte Miss Sara und ihr Geliebter, Mellefont auf, die beide vor Saras gestrengem, diese Beziehung nicht duldendem Vater Sir William Reißaus nahmen. Rechts davon das Zimmer der Marwood (Die Marwood - so glamourös, dass sie wie alle ganz Großen keinen Vornamen benötigt), der eifersüchtigen Ex von Mellefont, die Wind von der Sache bekam und nun mitsamt der gemeinsamen Tochter Arabella Mellefont hinterher reist, um ihn zu stellen. Und auch gleich Saras Vater Sir William verständigt, der sich nun seinerseits zusammen mit seinem Diener Waitwell aufmacht, um das Ausreißerpaar zu treffen - beide steigen im Zimmer links ab. Der Showdown kündigt sich an. Und im Vorfeld: Einblicke ins Seelenleben, Entfaltung des Dramas.
Und der Zuschauer staunt. Manchmal darüber, wie wenig sich zwischen 1755 und 2015 verändert hat, wie stoisch gleich die Gefühle bis ins Detail blieben - sogar dort, wo wir sie für modern und heutig halten würden. Und dann wieder wirken die damaligen gesellschaftlichen Konventionen und Rollenbilder, die damit einhergehenden Werte und ihre Sedimentierung in der Gefühlswelt eigenartig fremd und fern.
Es ist ein Verdienst dieser Inszenierung, beides präsent zu halten. Von manchem, was nicht mehr zeitgemäß war, trennte man sich. Die religiösen Skrupel Saras, ihre Furcht vor Sünde und Verdammnis etwa wurden gestrichen. Am deutlichsten aber ist der Eingriff in die Figur Marwoods, hier wird auch der gesellschaftliche Wandel am greifbarsten. Die Marwood wird sonst ja eher als Verführerin, Furie und wolllüstiges Weib (kurz: die Hure, Sara dann: die Heilige) negativ beleumundet. Hinzu kommt, dass sie bei Lessing einer Lügengeschichte überführt wird. Diese Stelle ist in der Inszenierung gekappt. Auch ist die Marwood hier keine Rabenmutter, die ihre Tochter bloß instrumentalisiert.
Heraus kommt nun: Eine zwar immer noch gefährlich überdrehende, aber abzüglich ihres Gewaltpotentials geradlinige, durchaus Verständnis und Sympathien verdienende Frau, eine Alleinerziehende, die unter falschen Vorwänden von ihrem Mr. Bindungsscheu Mellefont hingehalten und für eine Jüngere sitzen gelassen wurde ( - die er offenbar genauso hinhält).
Und apropos Gewaltpotential: Was die Marwood angeht, bleibt es hier beim Potential. Denn das tödliche Gift für Sara überreicht in dieser Inszenierung nicht sie selbst, sondern ihr eigen Fleisch und Blut, Tochter Arabella. Das macht Sinn, wie es auch Sinn macht, dass später nicht Mellefont sich selbst richtet wie bei Lessing, sondern in schöner Konsequenz seiner Schwäche und Unentschiedenheit auch das nicht hinkriegt. Weshalb der Nanny-gleiche Diener Waitwell dieses Geschäft übernimmt, ihn kurzerhand erwürgt und somit sein Saralein rächt.
Was Regisseur Dominik Günther da macht, sind keine mutwilligen Eingriffe, mit denen ein Spielleiter zeigen muss, dass er da war, sondern aus dem Mitdenken heraus entstehende Verlängerungen. Die Neu-Akzentuierung der Marwood darf sich dabei die Legitimation bei Lessing selbst holen: War der doch eine Lichtgestalt menschlicher Emanzipation. Nur das Frauenbild war damals noch nicht so weit, es gibt Schranken der Zeit, über die auch ein Theaterdichter nicht so einfach hinaus kann.
Vom Diener zum Mordtragöden
Im LTT kann man es aber, insofern, als hier kostüm- und ausstattungstechnisch Zeitlosigkeit herrscht, ein Mix aus heute und gestern, mehr heute, es wird mit dem Smartphone telefoniert, aber noch mit Schreibmaschine geschrieben.
Aber es wird Lessing gesprochen. Allerdings mit vielen Streichungen, in der Intonation manchmal sehr heutig klingend und da, wo es zu dicke wird, wählt man mitunter überkandidelte Parodie, die etwa als übermütiges Spiel eines Liebespaars wieder ihre konkrete Funktionalisierung bekommt - das ist schon recht schlau. Die Übergabe des väterlichen Briefes von Waitwell an Sara wiederum wird zu einer gutgelaunten Slapsticknummer in fernöstlicher Kampfsportart. Kurz: Die Inszenierung hat ihre amüsanten Verfremdungseffekte, auch solche der etwas müßigeren, Art. Da machen die alten Herren Sir William und Waitwell auf dem Hotelzimmer Liegestützen und messen ihren Puls. Und Arabella spielt auf der Flöte die Melodie aus dem Film Titanic.
Arabella, von Schauspielstudentin Carmen Witt mit viel Empathie und Hospitalismus gespielt, erfährt in dieser Inszenierung eine enorme Aufwertung. Ganz großartig aber vor allem die drei Hauptfiguren: Bei Franziska Beyer scheint ein geradliniger Weg von Miss Winehouse ("Forever 27") zu Miss Marwood zu führen, schon bei ihrem allerersten Femme-fatale-Walk über die Bühne weicht der Zuschauer unbewusst zur Seite, weil er für einen Moment vergisst, dass er ja auf seinem sicheren Platz sitzt.
Daniel Tilles Mellefont wiederum hat manche Eigenschaft seines Ben aus "Tag der Gnade" (jetzt beginnt so allmählich das Mosaik aus Schauspieler und Rollenvielfalt sich zusammenzusetzen), mit sehenswertem Hin- und Hergerissensein zwischen Familie und Geliebter, sympathisch und unsympathisch.
Und Carolin Schupa rettet Sara mit der ein oder anderen frischfrechen Note vor der reinen Schublade kindlich-naiver Engelhaftigkeit. Es wird wohl an ihrem Rollentext liegen, dass sie am ehesten eine Figur vergangener Zeiten bleibt, am schlechtesten modernisierbar.
Wer wiederum glaubt, dass Andreas Guglielmetti und Gotthard Sinn sich auf dem Ruf und den Meriten eines komischen Publikumslieblingsgespanns ausruhen könnten, der sehe sich nur mal den am Schluss aschgrau zur Säule erstarrenden, das Paradoxon aus Weltverbitterung und allumfassender Liebe auf den Punkt bringenden Sir William an. Oder Waitwell, wie er urplötzlich als grimmiger Mordtragöde einem Shakespearschen Königsdrama entsprungen sein könnte.
Doch, das ist alles sehr schön. Und empfehlenswert.
Unterm Strich
Leicht modernisiert und akzentuiert, dem Geiste und der Sprache Lessings aber so treu geblieben, wie es das Gebot der Vergegenwärtigung erlaubte, ein als schwer spielbar geltendes Stück frisch und packend gemacht - das gelingt nicht oft.
Reutlinger Nachrichten, 23. Februar 2015
(von Kathrin Kipp)
Regisseur Dominik Günther bringt Lessings museales Trauerspiel ganz ansehnlich auf die Bühne. Premiere war am Freitag.
Bei der Uraufführung 1755 seien die Leute noch vier Stunden "wie Statüen" dagesessen und "in Thränen zerflossen". Nun, ganz die sentimentale Wirkung hat das Rührstück heute nicht mehr, und auch die Gender- und Moralmuster sind nicht mehr ganz so knackfrisch wie damals.
Regisseur Dominik Günther braucht auch keine vier Stunden mehr für sein Trauerspiel, aber er behält die Lessingsche Sprache und Empfindsamkeit wie auch die strenge Sittenkonstruktion des 18. Jahrhunderts bei, nach der es praktisch nur zweierlei Frauen gibt: Heilige und Schlampen. Lessings Botschaft: Auch Heilige können mal egoistisch, Schlampen mal bedauernswert sein.
Man kann kaum zählen, wie oft das Wörtchen "Tugend" (meist im Sinne von "Jungfräulichkeit") gebraucht wird. Günther versucht trotzdem, das Stück ernstzunehmen, indem er eine psychologische Geschichte über die zeitlose Figurenkonstellation - zwei Frauen und ein Mann - erzählt, mit den ganzen zwielichtigen Gefühlen wie Eifersucht, Sich-nicht-festlegen-wollen und Besitzenwollen, Gier und Rachegelüsten, die so eine Dreierkonstellation eben mit sich bringt. Weil aber das Denken, die Geschlechterrollen und das starre bürgerliche Moralsystem doch recht altbacken daher kommen, muss man als Zuschauer sehr viel Übersetzungsleistung erbringen, bis alles wenigstens ein bisschen nachvollziehbar wird.
Lessing wollte mit seinem Stück wahrscheinlich ein klein wenig Mitleid schüren mit gefallenen Frauen à la Sara Sampson. Die wiederum wäre gerne ein heiliges, tugendhaftes, bescheidenes und demütiges Wesen - sprich: todlangweilig. Wenn da nicht die Liebe wäre. Seit ihrer Flucht mit ihrem Lover besteht Sara nur noch aus schlechtem Gewissen. Eigentlich ist sie ein Fall für den Psychoanalytiker, da schon in ihrer Kindheit einiges schief lief: dominanter, konfliktscheuer Vater und tote Mutter, für deren Tod (bei Saras Geburt) sie sich ebenfalls verantwortlich fühlt. Und so kann die kleine, zwanghafte Sara nur glücklich werden, wenn alles nach betoniert bürgerlichem Muster abläuft: Heirat und Sicherheit, sonst Alpträume, Verlustvisionen. . .
Weil in dieser Inszenierung aber alle Figuren recht markant gezeigt und mit einem veritablen Tick versehen werden, spielt auch Carolin Schupa eine ziemlich aufgeweckte Sara, die freudig auf ihrem Hotelbett herumhüpft, Pferdebilder aufhängt, einen Hang zum Rollenspiel hat und sich mit ihrem ehemaligen Diener (Andreas Guglielmetti) fetzige Kampfsportszenen liefert.
Ein quirliges, aber auch sehr nerviges Girl, das ihrem Geliebten Mellefont (Daniel Tille) mit ihrem Heiratswunsch pausenlos das Ohr abkaut, dass er einem fast schon wieder ein bisschen leid tut. Im Grunde ihres romantischen Herzens ahnt Sara wahrscheinlich, dass bei ihrem charmanten Hallodri und Tunichtgut nicht viel zu holen ist: Das unstete Bienchen hüpft von Blume zu Blume, amüsiert sich und will es am Ende allen Blümchen recht machen. Er will zwar lieben, aber wenn er lieben muss, bekommt er die Krise. Und weil sich sein Lover to go vor lauter Liebesmüh nicht entscheiden kann, rennt Daniel Tille am liebsten hektisch auf dem Hotelflur herum und schüttet plastikbecherweise Kaffee in sich hinein. Auch er hat permanent ein schlechtes Gewissen, hat er doch für Sara seine Ex-Geliebte (Franziska Beyer) samt Tochter (Carmen Witt) sitzen lassen, die ihn nun mit allen Mitteln der Überzeugungskunst (Belaberung, Bezirzung, Erpressung, Intrige, Mitleidstour, Gewalt) zurückzuholen versucht.
Franziska Beyer ist als Marwood ein sehr wandlungsfähiges Wesen, ein charmantes wie durchtriebenes, billiges wie demonstrativ falsches Chamäleon. Und so trifft man sich in Tübingen in einem modernen Hotel (Bühne: Sandra Fox) mit aneinander gereihten Zimmern, in denen sich alle immer mit irgendetwas beschäftigen: An- und Ausziehen, Gymnastik, Bravo lesen, in den Bettdecken herumwühlen.
Auch Saras Vater (Gotthard Sinn) ist da, er will sich mit seiner Tochter versöhnen, weil er sie für sein einsames Alter braucht - hier ist eben jeder auf seine Art egoistisch, auch wenn alle noch so tugendhaft rumtun. Saras Vater ist noch ganz Generation Brief: Anstatt persönlich mit seiner Tochter nebenan zu quatschen, schreibt er ihr lieber Briefe und macht Liegestütze.
Für den tragischen Schluss aber hat sich Regisseur Günther noch ein paar hübsche Mordvarianten einfallen lassen: Nicht Marwood reicht der Rivalin das Gift, sondern ihre alterlose Tochter Arabella (Carmen Witt), die im ganzen Stück wenig Text, dafür umso mehr Gefühle hat, die sie mit ihrer Blockflöte zum Ausdruck bringt. Wie die Mutter (Erbschuld oder miese Erziehung?) entpuppt sie sich als vergiftetes, böses Luder. Und so fragt sich das Stück auch, wie viel Teufel wohl in jedem Menschen so steckt. Mellefont schafft es als schwache Type nicht einmal, sich selbst zu erdolchen. Da muss der gute Diener Waitwell ran. Am Ende liegen sich allerdings alle wieder in den Armen und verzeihen sich. Da ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten.
Reutlinger General-Anzeiger, 23. Februar 2015
(von Heiko Rehmann)
Inszeniert auf einer Simultanbühne: Gotthold Ephraim Lessings »Miss Sara Sampson« am LTT
Liebe, Eifersucht und schließlich ein tragischer Tod: Noch 260 Jahre nach seiner Erstaufführung wirkt Gotthold Ephraim Lessings bürgerliches Trauerspiel »Miss Sara Sampson« erstaunlich modern. Die Charaktere kennen wir alle aus unserer eigenen Lebenserfahrung: Sara, das naiv liebende Kind, Mellefont, der bindungsunwillige Frauenheld, Marwood, die tief gekränkte Ex-Geliebte, die alles tut, um Mellefont zurückzugewinnen.
Dominik Günthers Inszenierung, die am Freitagabend Premiere am Landestheater Tübingen hatte, lässt diese Aktualität deutlich hervortreten. Ein modernes Hotel ist der Ort, an dem sich die Handlungsstränge kreuzen, in jedem Zimmer stehen die gleichen Betten, nüchtern und praktisch durchgestylt. Sandra Fox hat ihr Bühnenbild als Simultanbühne angelegt.
Das Zimmer, in dem Sara mit Mellefont nach der spontanen Flucht vor ihrem Vater abgestiegen ist, liegt zwischen dem Zimmer von Marwood und dem ihres Vaters, Sir William Sampson, nur durch Bilder abgetrennt. Der Zuschauer sieht somit alle Personen zugleich, die Szenen gehen direkt ineinander über, was dem Spiel eine enorme Dynamik verleiht. Witzige Regieeinfälle lockern die Inszenierung auf. Mal gibt es Kampfsport-Einlagen in Zeitlupe, mal legt sich Saras Vater mit seinem Diener quer über zwei Betten, um vor Freude Liegestütze zu machen.
Sara liest Wendy-Hefte
Sara ist zerrissen zwischen ihrer Liebe zu Mellefont und ihrem Gewissen, das diese voreheliche Affäre verurteilt. Weil ihr Vater der Verbindung nicht zustimmen wollte, ist sie geflohen und lebt seit acht Wochen in dem Hotel. Täglich bestürmt sie Mellefont, sie endlich zu heiraten, doch der ziert sich. Schließlich muss er noch eine Erbschaftsangelegenheit regeln und Marwoods Eifersucht besänftigen, wovon Sara jedoch nichts weiß. Carolin Schupa spielt Sara als die naiv Liebende, die verträumt im Bett liegt und Wendy-Hefte liest. Die vor Aufregung mit den Füßen trampelt und die ihrem Geliebten leidenschaftlich um den Hals fällt. Die kindisch und tollpatschig wirkt und zugleich auch frühreif erwachsen.
Daniel Tille gibt den Mellefont als abgeklärten Verführer, der immer hektischer wird, je mehr ihm das Spiel mit den beiden Frauen entgleitet. Sara hüpft vor Freude in ihrem Bett auf und ab, wenn sie Mellefont sieht, und sinkt niedergeschlagen in sich zusammen, als dieser sie immer noch nicht heiraten will. Er rennt zunehmend kopfloser über die Bühne, gestikuliert, spricht atemlos, versucht zu retten, was zu retten ist. Dennoch bleiben die beiden Hauptfiguren etwas blass.
Dynamik gewinnt die Inszenierung erst mit dem Auftritt von Franziska Beyers Marwood und Carmen Witts Arabella, der gemeinsamen Tochter Marwoods und Mellefonts. Marwood zeigt sich als tief gekränkte Frau, die zum fauchenden Drachen wird. Als ein »getretener Wurm, der sich krümmt und dem, der ihn getreten hat, gerne noch die Ferse verwunden möchte«. Ihre Blicke funkeln wie Dolche, ihre Mimik und Gestik drücken ebenso viel Wut wie Verwundung aus. Arabella fällt ihrem Vater besinnungslos um den Hals, voller Hoffnung und Hingabe. Sie springt leichtfüßig über die Bühne und verdreht die Augen, voller Sehnsucht nach echter Bindung. Am Ende flößt sie Sara das Gift ein, das diese töten wird. Dann dreht sie den leeren Becher um und schickt einen Blick über die Bühne, der ohne Worte alles sagt.
Gotthard Sinn spielt Saras Vater Sir William Sampson mit Ruhe und britischem Understatement, ebenso wie Andreas Guglielmetti den Diener Waitwell, der alles tut, um die Tragödie zu verhindern und dem Vater sein Kind zurückzugeben, und der am Ende nur die Toten beklagen kann.