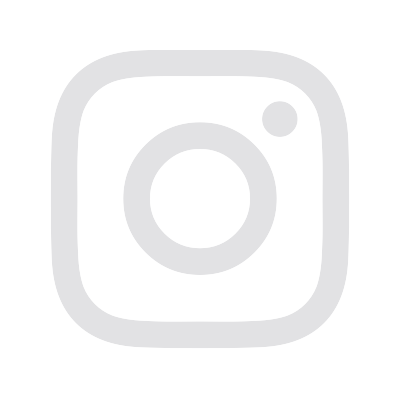Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.










Eine Klassikerüberschreibung von Maria Milisavljevic nach Henrik Ibsen · 15+
Reutlinger General-Anzeiger, 14. April 2025
Scheitern eines weiblichen Egos
(von Thomas Morawitzky)
Ibsens »Peer Gynt« bekommt in der Überschreibung von Maria Milisavljevic´ eine doppelte Titel-Antiheldin
»Ich« ist ihr erstes Wort. »Ich blende alle Gerüche aus und höre nur das leise Rieseln des Sandes.« Henrik Ibsens »Peer Gynt« ist die Geschichte eines Träumers, der hinauszieht in die Welt. Mit anderen Worten: eines Egoisten auf der Suche nach sich selbst. Er stammt aus ärmlichen Verhältnissen, träumt sich fort, lügt, nimmt keine Rücksicht, verletzt, steigt auf, wird reich und mächtig, stürzt ab. All dies verwoben in die Bilderwelt nordischer Mythologie: ein seltsam verklärter negativer Bildungsroman, ein episches Gedicht für die Bühne, entstanden vor rund 180 Jahren und von bemerkenswertem Erfolg.
Die Werk- und Wirkungsgeschichte schwingt mit am Freitagabend im LTT, als Friederike Drews Inszenierung von Maria Milisavljevic’ Überschreibung des berühmten Stoffes dort Premiere feiert. Und doch ist etwas anders, denn Peer Gynt ist eine Frau: »Peer Gynt (She/Her)« lautet der Titel des Stückes.
Mehr noch: Milisavljevic´ lässt die gealterte Peer Gynt zuerst auf der Bühne erscheinen, um die Abenteuer ihres jüngeren Ichs zu verfolgen. Franziska Beyer ist zu sehen in der Rolle der verhärteten Frau, die die Welt erobert hat, ohne sich zu finden; Robi Tissi Graf ist an diesem Abend ihre jüngere Version.
Vorgesehen für diese Rolle war Rosalba Salomon – sie zog sich wenige Tage der vor der Premiere eine Verletzung zu. Wie Robi Tissi Graf nun zur jüngeren Peer Gynt wird, in dieser komplexen Rolle aufgeht – das will man kaum glauben, so sehr gelingt es. Und auch, dass Paula Aschmann kurzfristig anreiste, um jene Rollen zu übernehmen, die Graf zuvor innehatte.
»Peer Gynt (She/Her)« entpuppt sich weniger als eine Neuauflage des Klassikers mit anderen Vorzeichen. Das Stück wirkt vielmehr wie ein Remix des Originals, das viele weitere Bezüge einbringt. Der Zauberer von Oz tritt auf, wenn Robi Tissi Graf »Somewhere Over The Rainbow« singt, das Lied zunehmend grotesk und animalisch intoniert.
Ev Benzings Bühne bringt im ersten Teil eine Autostraße auf die Bühne, als Asphaltstreifen, der in die weite Welt führt, tristes Echo der »Yellow Brick Road« im märchenhaften Land. Felsbrocken liegen ihr zur Seite; gegenüber, als Hochstand, die Waldhütte, in der der junge Peer Gynt sich versteckt, in die er Ingo (Lucas Riedle) entführt und von sich stößt.
Wie eine Frau, die sich gegen die vorbestimmte Rolle auflehnt, kann Peer in dieser Szene noch gesehen werden. Im zweiten Teil dann ist aus der Straße eine Spielzeug-Autorennbahn geworden, die vor der Bühne steht. Was groß war, wird klein, bedeutungslos. Auf dem T-Shirt der jungen Peer steht in großen Buchstaben »Ich«. Auch die ältere Peer trägt ein weißes T-Shirt. Darauf steht, klein geschrieben: »moi«.
Reich geworden und abgestürzt
Franziska Beyer als jene Peer, die durch Sklavenhandel reich geworden ist, tritt ihrer Vergangenheit mit der Enttäuschung eines Menschen gegenüber, der weiß, dass die Welt den Verrat nicht wert war. Sie wirkt müde und schläft denn auch sitzend, während Lucas Riedle, nun als junger Kerl, den ganzen Hausrat davonschleppt, einschließlich der modernen Kunst. Paula Aschmann und Jonas Hellenkemper treten auf als Dorfbewohner, von Anna Weidemann in graue Kostüme gekleidet, ein unwirkliches Duo, das an Kafkas Gehilfen erinnert. Rolf Kindermann, in mehreren Rollen, schreitet sarkastisch vorüber, ist der verzweifelte Passagier, der Peer Gynt auf dem sinkenden Schiff zuruft: »Was soll aus meinen Kindern werden? Die haben nur mich!« – »Ich hab auch nur mich!«, ruft Peer Gynt zurück. Jennifer Kornprobst zeigt Aase, Peer Gynts Mutter, mit einem langen Monolog, eine Frau mit leidendem Blick; Solveig Eger spielt Solveig und die Trollkönigin, die gegensätzlichen Geliebten Peers, springt als Trollin vital umher, wird Peer Gynt verfolgen, wie all die anderen Gestalten, die immer wieder aus den Kulissen hervorspähen.
Geschlechtertausch mit Folgen
Geht die Überschreibung mit neuen Geschlechtspronomen einmal nicht ganz auf (schließlich zeugte Peer Gynt ein Kind), wird mit frecher Ironie weitergespielt. Die Schatten der Irren (Kornprobst, Aschmann, Eger) flackern auf den kahlen Wänden, als Peer Gynt in der Anstalt landet. Und Edward Griegs »Morgenmusik« erklingt, als er schon fast am Ende ist. Ein wenig Edgar Allan Poe darf auch noch in den Mix – denn wenn der Tod einer schönen Frau das »poetischste Thema der Welt« ist – was ist der Tod einer gewöhnlichen Frau?
Peer Gynt wird zur Frau, oder zu zwei Versionen einer Frau, sich selbst im Spiel betrachtend – ein Geschlechtertausch mit ungeahnten Folgen. Der Aufstand gegen das Patriarchat, der im ersten Teil des Stückes noch deutlich ausgesprochen wird, lässt eine Peer Gynt entstehen, die die Welt als Narzisstin gemeistert hat und sich in nichts unterscheidet von jedem zynischen weißen Mann.
Maria Milisavljevic´’ Version des Ibsen-Stoffes wurde 2021 als Auftragsarbeit am Theater Regensburg uraufgeführt – lange ehe Donald Trump den Gaza-Streifen in einen Golfclub verwandeln wollte. Aber an nichts anderes denkt man nun, wenn Peer Gynt davon träumt, die Wüste in ihr grenzenloses Egoland Gyntiana zu verwandeln.
Schwäbisches Tagblatt, 14. April 2025
(von Moritz Siebert)
Lauf, Peer Gynt, lauf: Das LTT lässt Peer Gynt (she/her) gegen das Patriarchat kämpfen und versucht, diese ambivalente Figur zu ergründen.
So verschieden sind Trolle und Menschen ja nicht, bis auf den Schwanz. Bei Henrik Ibsen ist es der Trollkönig und Brautvater, der dem jungen Peer Gynt einen ansteckt, um ihn ausreichend für die Hochzeit mit seiner Tochter auszustatten. Wenn nun aus Peer Gynt eine Peer Gynt wird, die gegen all das Vorgeschriebene, gegen gesellschaftliche Konventionen inklusive patriarchaler Strukturen kämpft, dann liegt es wohl nahe, dass aus diesem Schwanz ein Schwanz wird. Ein Schwanz als Bedingung für die Ehe mit der Tochter. Mit einem Schwanz, werben die Trolle, habe man doch gleich eine andere Perspektive: Du wirst sehen, liebe Peer Gynt, mit einem Schwanz lebt es sich doch viel leichter!
Selbstverständlich lehnt Peer Gynt ab. Peer Gynt bleibt Peer Gynt. Das LTT zeigt Maria Milisavljevics Überschreibung von Henrik Ibsens Klassiker mit dem Titel „Peer Gynt (she/her)“. Regie führt Friederike Drews. Für die Premiere musste das Team beim Personal improvisieren, weil sich Rosalba Salomon, Darstellerin der jungen Peer, verletzt hat. Robi Tissi Graf sprang kurzfristig ein, Paula Aschmann übernahm Grafs Rollen (Grüngekleidete, Dorfbewohnerin, Reiche, Irre). Und, hätte das niemand angekündigt, wäre es denn aufgefallen? Graf spielt die junge Peer Gynt großartig, eine unangepasste Draufgängerin, die darauf scheißt, was die Leute sagen, deren Drang, aus der Enge des Heimatdorfs auszubrechen, spürbar ist. „Brat“ wäre heute vermutlich die passende Bezeichnung. Aber sie ist auch eine Peer, deren Rücksichtslosigkeit und Egozentrik geradezu schmerzt, eine Peer, der man heute vermutlich nicht nur ADHS diagnostiziert hätte.
Milisavljevic splittet die Hauptrolle in zwei Peers, eine junge und eine etwa 20 Jahre ältere (Franziska Beyer). Die beiden begegnen sich, tauschen sich aus, kommentieren ihr Handeln gegenseitig. Grundsätzlich konzentriert die Autorin das Stück auf eine starke Zweiteilung. Die Bühne (Ev Benzing) ist in der ersten Hälfte von einer Straße dominiert, die, symbolträchtig, nur mit viel Fantasie ins Unendliche führt, in Wirklichkeit eher eine Sackgasse ist. Perspektivwechsel nach der Pause: Die junge, rastlose Peer beobachtet das Leben der alten, stinkreichen, aber ebenfalls rastlosen Peer – bezeichnenderweise von oben über den Kulissenrand. Die Bühne wird Interieur, in dem Peer ihren Reichtum zeigt, mit Sichtbeton, Designermöbeln und barock gekleideter Entourage (Kostüme: Anna Weidemann), mit gähnender Langeweile und Oberflächlichkeit.
Es dreht sich alles um Peer, aber um das zu verdeutlichen, braucht es eine Menge Nebenfiguren. Das Ensemble ist in vielen Mehrfachrollen zu sehen: Solveig Eger ist Trollkönigin, Irre und Solveig, Lucas Riedle ist der Bräutigam, den Peer ausspannt, Troll, Reicher, junger Kerl und Schiffskoch, Rolf Kindermann ist Knopfgießer, Troll und Händler, Jonas Hellenkemper Dorfbewohner, Troll und Händler.
So weit entfernt sich Milisavljevic bei ihrer Überschreibung tatsächlich nicht von der Vorlage, Handlung und Figuren sind erhalten, auch viel Originaltext. Edvard Griegs Schauspielmusik zu Peer Gynt, mindestens so berühmt wie Ibsens Bühnenstück selbst, deutet die Inszenierung an, in der „Halle des Bergkönigs“ läuft Techno.
Peer Gynt ist kein Held, auch keine Heldin, sondern eine höchst ambivalente, in der Tübinger Inszenierung eine ziemlich kaputte Figur. Die Tragik beginnt mit den schlechten Voraussetzungen: Der Vater hat sich zu Tode gesoffen, die Mutter (Jennifer Kornprobst), schwer depressiv, verzweifelt an der Tochter. Die Dorfgemeinschaft verachtet Peer. Was bleibt, als in Geschichten zu flüchten?
Die Unzufriedenheit und Rastlosigkeit der jungen Peer spürt auch die ältere, abgeklärte Peer, aus dem jugendlichen Trieb zum Ausbruch ist eine innere Leere geworden. Die Möglichkeit, dass Peer sich selbst begegnet und beobachtet, nutzt die Autorin für eine ausführliche Selbstreflexion der Figur, das Stück wird so auch zum Psychogramm. Der Dialog zwischen Jung und Alt erklärt – leider auch immer wieder Offensichtliches.
Manche Szenen mögen sich ziehen, in der Summe gelingt es dem Stück aber, die Düsterkeit mit ständigem Nachdenken über das Leben und Handeln der Peers mit humoristischen Momenten und Exkursen in die Gegenwart zu lockern: Der „junge Kerl“ kontrastiert Jugendslang mit Ibsen, die alte Peer erklärt anderen Neureichen, wie westliche Demokratien Reichtum ermöglichen – „es geht um das Bohren von Löchern“ –, oder dem Publikum das Prinzip von „Female choise“.
Die Erzählweise der Autorin mit zwei sich begegnenden Peers in unterschiedlichen Lebensphase ermöglicht es, Erlebtes retrospektiv, Künftiges als Vision wahrzunehmen. Das Zusammenspiel von Realität und Fantasie, gegen deren Trennung Peer am Ende auch kämpft, bekommt ein anderes Gewicht: Vielleicht hat Peer Gynt sogar die Chance auf eine frühere Erkenntnis, wo ihr Königreich eigentlich liegt – und was es ist.
Nachtkritik, 12. April 2025
(von Steffen Becker)
Maria Milisavljevic hat Henrik Ibsens Drama um ein Pronomen erweitert und doppelt weiblich besetzt. Regisseurin Friederike Drews inszeniert das in Tübingen als Zwiegespräch zweier Alter Egos.
"Nimm den Schwanz, das Leben ist einfacher mit so nem Schweif." Die Trollkönigin wedelt mit einem Umschnalldildo. Kurz zuvor hatte Peer Gynt mit einer Schrei-Version von Judy Garlands "Over the rainbow" um die Hand ihrer Tochter gebuhlt. Aber der Schwanz ist dann doch ein zu großer Preis. Peer Gynt ist anders aus Überzeugung. Und in der Klassikerüberschreibung von Maria Milisavljevi? – uraufgeführt am Landestheater Tübingen – ist Peer eine Frau, die nicht nach den Regeln des Patriarchats spielt.
Dass Peers Geschlecht eine tragende Rolle spielt, markieren nicht nur die Pronomen (she/her) im Stücktitel, sondern auch eine Einleitung über nicht mehr blutjunge Frauen als unsichtbare Grashalme der Gesellschaft und eine Interpretation von Whitney Houstons "I am every woman". Das ist der rote Faden der Inszenierung von Friederike Drews. Ihr Peer Gynt steht stellvertretend für die Frau, die den Verhältnissen entkommen will – und es dabei schwerer hat als der Ibsen-Typ.
Der Ausbruch aus der Enge eines kleinen Dorfs erst in eine Traum- und dann in die weite Welt ist in Tübingen eine Blaupause für Brechstangen-Emanzipation. Zusätzlich verschränkt Autorin Milisavljevi? die beiden Hälften des Klassikers. Die junge und alte Peer Gynt begegnen sich und treten ins Zwiegespräch. Ein Kniff mit Licht und Schatten.
Franziska Beyer als "alte" Peer und Robi Tissi Graf als ihr jüngeres Ich sind im Zusammenspiel ein unverhoffter Glücksgriff (Graf sprang für eine verletzte Kollegin ein). Sie schaffen es tatsächlich wie die gleiche Person in verschiedenen Lebensstadien zu wirken (Modell "bad ass bitch"). Rücksichtslos und als Heldinnen herausfordernd ambivalent sind sie beide. Graf legt den Fokus auf die Wut auf die Zwänge, mit denen sie konfrontiert wird. Bei Beyer ist diese dem altersweisen Zynismus einer Frau gewichen, die das Spiel kennt, aber satt hat. Das Motiv der Selbst-Suche in einer Welt, die anderes als dieses Selbst von einer erwartet, rückt durch ihre Interaktion und den Geschlechter-Aspekt deutlicher in den Vordergrund.
Nachteil der Doppelspitze: Die Dialoge zwischen Alt und Jung sind teilweise holzschnittartig erklärend, als wolle die Autorin absolut sichergehen, dass ihre Abweichungen von Ibsen auch wirklich, wirklich verstanden werden. Um es mit Peer Gynt zu sagen: "Das wäre mir zu plump."
Auch die Bühne probiert es teilweise mit dem Holzhammer: So endet die Straße am Dorf, die Peer Gynt trotz Verbot betritt, mit einer symbolischen Aufprallkante (!!!). Subtiler wird es erst nach der Pause. Die "alte" Peer zeigt Reichtum und Macht durch eine Ansammlung von Trophäen, arrangiert als Demonstration des "Wo ich schon alles war" an der Wand. Dabei taucht auch die Form eines Felsens aus einer Anfangsszene als fernöstlich anmutendes Kunstwerk wieder auf. Solche Querverweise lockern einen Abend auf, der ansonsten durch sein Ausbuchstabieren des anti-patriarchalen Sujets manchmal zäh zu werden droht.
cul-tu-re.de online, 12. April 2025
„Peer Gynt (she/her)“ – Ein Zauberkasten
(von Martin Bernklau)
Respekt! Am Tübinger LTT hatte am Freitagabend Maria Milisavljevic Gender-Variante von Henrik Ibsens Weltgedicht eine Premiere mit Hindernissen
Respekt! Was das Tübinger LTT nach diesem Missgeschick mit Maria Milisavljevics sogenannter Klassiker-Überschreibung nach Henrik Ibsen (1842 bis 1906) da noch aus dem Hut gezaubert hat, war wirklich phänomenal: Rosalba Salomon, für die tragende Rolle der kleinen „Peer Gynt (she/her)“ vorgesehen, war mit dem Knie umgeknickt und (offenbar zudem noch ziemlich kurzfristig) ausgefallen.
Robi Tissi Graf als Einspringerin bekam einen Knopf ins Ohr, ebenso die aus München eingeflogene Paula Aschmann. Viel Arbeit für die Soufflage. Neben einer der acht Hauptpartien ging es da um über 20 Nebenrollen – von norwegischen Dörflern bis zu Trollen, Irren, Seeleuten und versnobten Jet-Set-People, die Regisseurin Friederike Drews neu durchmischen musste.
Peer Gynt, der „nordische Faust“ Henrik Ibsens, ist eine genauso seltsame Figur wie Goethes vielfach gebrochener und facettierter Held, auch er einer Art märchenhaftem Weltgedicht entsprungen und nicht so besonders gut für ein knackig stringentes Bühnendrama geeignet.
Maria Milisavljevic, 1982 geboren und in vielerlei Sparten mit Preisen und Erfolgen bedacht, hat den Stoff schon vor vier, fünf Jahren als Hausautorin fürs Theater Regensburg gegendert, als so etwas noch für ein bisschen aufregender, innovativer oder gar revolutionärer galt als mittlerweile. Dabei zeigt sie eine fast zärtliche Liebe für die gebundene bis gereimte Sprache von Ibsens Vorlage, die stellenweise sogar weit über jeden Hohen Ton des Theaters hinausgeht und ganz witzig mit Szene-Sprech und dem Raunen von Märchen, philosöphelnder Identitäts-Psychologik und klassenkämpferischer Kapitalismuskritik kombiniert wird.
Zwar hat sich Maria Milisavljevic – und mit ihr wohl dann alle Regisseure einschließlich Friederike Drews – heillos dabei überfordert und jedes Publikum auch, zumal sie ihre schillernde Titelheldin noch einmal in die Alte und die Junge aufsplittet. „Moi“ und „Ich“ heißen sie laut T-Shirt-Aufdruck. Dieses Spiegeln der Geschlechterrollen, rein praktisch überhaupt nicht stimmig durchzuhalten schon wegen der anderen Figuren, ist bereits im Binnengeschehen, also bei der schlichten Story, die halt ihre dramaturgische Logik braucht, unglaublich anstrengend zu verfolgen – von der nordischen Märchenebene nicht zu reden. Die Zuschauer sind auch ständig genötigt, sich abgleichend die Frage zu stellen: Was macht Maria Milisavljevic mit Ibsen, „ihrem“ Ibsen, mit ihrer Peer Gynt, wo will sie kritisieren, aktualisieren, weiterführen, umwerfen oder auch bewahren?
Aber andererseits hat sie für jede Inszenierung einen Zauberkasten geöffnet, der ihre Vorlage, dieses Wunderwerk an kindlicher, kultureller und auch ethnografisch volkstümlicher Fantasie noch einmal geradezu übermütig werden lässt. Friederike Drews und ihre Ausstatterinnen Eva Benzing (Bühne) und Anna Weidemann (Kostüme) nutzen das voll aus.
Das geht dann natürlich soweit (und darf es auch), dass diese ganze Ebene von Symbolen, Allegorien, zugespitzter Karikatur und vieldeutiger Offenheit selbst fürs gebildetere Publikum nicht mal mehr halbwegs mehr plausibel zu entschlüsseln, also buchstäblich im Wesentlichen – und darauf kommt es an beim „Peer Gynt“-Stoff – wie ein Zeichensystem zu dechiffrieren ist, sondern vom Vagen und Vieldeutigen bis ins Beliebige abrutschen kann. Also selbst in Spielerei, Effekt, ja Klamauk.
Neben den Einspringerinnen – ganz großartig! – sollen zwei, drei weibliche Rollen aus der Ensemble-Leistung hervorgehoben sein. Da ist natürlich Franziska Beyer, die den ganzen weiten Weltenweg ihrer älteren Peer Gyntin mit der Strahlkraft eines Regenbogens bis zum berühmten Zwiebel-Monolog zu spannen versteht. Da ist Solveig Eger, die ihrer Namenspatronin eine sehr subtile Färbung gibt, aber auch als Troll-Königin fulminant auftrumpfen kann. Und da ist Jennifer Kornprobst, die Peers Mutter, der Säufer-Witwe, dem „Vieh“, als bedingungslos liebendes Muttertier eine ergreifende Tiefe gibt. Sie erfährt dafür im Sterben Trost und Dankbarkeit von ihrem Kind.
Bei den Männern setzt Lucas Riedle vor allem als „junger Kerl“ besondere Glanzlichter, aber auch Jonas Hellenkemper und Rolf Kindermann spielen ihre je eigenen Potentiale sehr beachtenswert aus. Ein Lob für die Musik auch, die vom „Rainbow“ über Schuberts „Ave-Maria“ und Leonard Bernsteins „Glitter and be gay“ bis zu den romantischen Originalklängen von Edvard Griegs Bühnenmusik und seiner Doppel-Suite reicht.
Es wird geklatscht, gejubelt und fanmäßig gedröhnt am Ende dieser nicht ganz ausverkauften Premiere – wenn auch nicht übertrieben ausdauernd nach einer doch ziemlich langen Vorstellung.