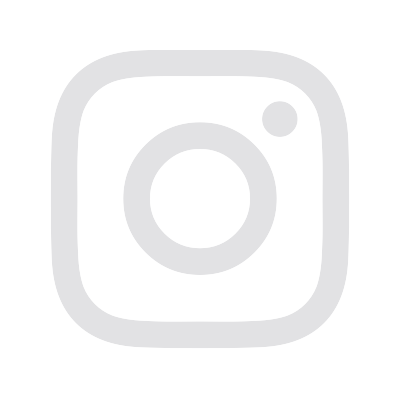Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.

















Schauspiel von Samuel Beckett · Deutsch von Elmar Tophoven
Schwarzwälder Bote, 7. Oktober 2019
Regie zwischen Komik und Tragik
(von Christoph Holbein)
„Warten auf Godot“ auf klassisch-konventionellen Pfaden
Das Schauspiel „Warten auf Godot“ von Samuel Beckett ist ein Klassiker unter den immer wieder aufgeführten Theaterwerken. Und ebenso klassisch-konventionell inszeniert Regisseur Thorsten Weckherlin das Stück in der Werkstatt des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT). Weckherlin lässt sich auf keine Experimente ein, bürstet nicht gegen den Strich und bewegt sich damit mit seiner Regiearbeit im erwarteten Aufführungsrahmen.
Der Regisseur vertraut auf die Kraft des grotesken Geschehens auf der Bühne und kann sich dabei auf die Spielfreude seines Ensembles verlassen. Denn die Inszenierung lebt vor allem durch das vitale und äußerst präsente Agieren der Protagonisten auf ansprechendem Niveau. Für die dafür notwendige intensive Atmosphäre sorgt das Bühnenbild von Vinzenz Hegemann: eine Hausruine mit abgebrochenen, zerfallenen Mauern und einem kahlen Baum, der aus dem aufgebrochenen Boden der Holzdielen wächst.
Dort warten Wladimir und Estragon – kongenial dargestellt von Gilbert Mieroph und Andreas Guglielmetti - auf einen Mann namens Godot, von dem sie nichts wissen, dessen Erscheinen aber für die Beiden so lebenswichtig ist, dass sie ausharren: „Wir finden doch immer was, nicht wahr, Didi, was uns glauben lässt, dass wir existieren.“
Die Szenen, die Weckherlin kreiert, sind austariert, entbehren nicht eines gewissen Slapsticks und arbeiten die leise Komik gut heraus. Das hat eine stimmige Dynamik und ein passendes Tempo. Die Figuren sind in ihren Facetten und Charakteristiken fein ausgekostet. Da stehen auch Rolf Kindermann als Pozzo, jener peitschenknallende und sadistische Herr und Machtmensch, sowie Stephan Weber als dessen Knecht und Sklaven Lucky in ihrem Spiel in nichts nach. Estragon und Wladimir treiben derweil das Clowneske in skurrile Höhen. Das ist überspitzt, aber dennoch gut gespielt und schauspielerisch in seiner ganzen grotesken Szenerie fundiert erarbeitet. Stephan Weber etwa brilliert in seiner Monolog-Szene, wenn er - den Strick um den Hals - aufgehend in seiner Rolle zum Denken gezwungen wird, um dann beziehungslose Wissens- und Bildungsfetzen mechanisch hervorzuwürgen - immer wieder mündend in den ewigen Refrain: „Man weiß nicht warum.“
So entstehen eindringliche Bilder. Da geht der Mond im Hintergrund am Himmel auf. Da hat der Baum im zweiten Akt nun grüne Blätter. Das alles ist plakativ inszeniert und gibt auch ein paar Gags zum Besten, beispielsweise beim Hutwechselspiel, beim Beschimpfungs-Duell, bei der Aufstehen-Akrobatik der beiden philosophischen Clowns Estragon und Wladimir. So hinterlässt das Spiel der Protagonisten einen starken und intensiven Eindruck, von dem letztlich die mehr als zweistündige Inszenierung lebt und getragen wird.
Schwäbisches Tagblatt, 30. September 2019
(von Peter Ertle)
Und da sie nicht gestorben sind, warten sie noch heute – auf Godot. Thorsten Weckherlin akzentuiert die Identität Wladimirs und Estragons, vor allem aber ihr Bulletin: Es geht ihnen den Umständen entsprechend überraschend gut.
Wladimir und Estragon - wer waren sie nicht schon alles. Landstreicher, Clowns, ein altes Ehepaar. . . um nur mal drei beliebte Figurenpaare zu nehmen. George Tabori hat sie 1984 als Flüchtlinge auf die Bühne gestellt, auch das lag nie so fern – zumal Beckett in der résistance war.
Vor einigen Jahren nun hat ein Literaturwissenschaftler ziemlich plausibel nachgewiesen, dass dieser Aspekt im Stück deutlicher sichtbar ist als bislang beachtet. An dem, was „Warten auf Godot“ ist, ändert das kaum etwas, denn dass das Absurde gelegentlich im Realen zur Erscheinung kommt, ist ja nun bekannt. Wer in Marseille 1941 einen undurchsichtigen Behördenmarathon bis zum Sankt Nimmerleinstag der Ausreise erlebt (zu sehen in Premiere 1, siehe auf dieser Seite oben) oder als Jude in einer Stadtruine Tag für Tag vergeblich auf seinen Schleuser wartet, der ihm die Flucht vor den Nazis ermöglichen soll – der macht gewiss eine existentielle und zutiefst absurde Erfahrung. Das ist das eine.
Das andere ist, dass Beckett alles dafür getan hat, diesen konkreten Aspekt klein und die allegorischen Möglichkeiten offen zu halten. Einem Schriftsteller, zumal einem, der in Deutsch, Englisch und Französisch so zuhause war wie Beckett, passiert es nicht versehentlich, wenn im Namen der titelgebenden Hauptfigur das englische Wort god und – von hintenrein - das deutsche Wort Tod nebeneinander liegen wie die Nullen der liegenden Ewigkeitsacht.
So irritiert allenfalls, dass das LTT in seiner Stückankündigung ein vergleichsweise großes Gewese um den Ansatz mit den beiden jüdischen Flüchtlingen macht. In der Inszenierung selbst macht es Thorsten Weckherlin dann klug, er hält den Referenzrahmen klein. Unter dem Hut kringelt sich ein orthodoxes Löckchen, hinten an der Wand ist sehr klein und fast zu übersehen ein Judenstern aufgezeichnet – und das Ganze spielt in einer Kriegsruinenlandschaft (Bühne: Vinzenz Hegemann), hinter der manchmal der Mond aufgeht. Oder ist es gar die Erde?
Davon abgesehen: Eine im besten Sinne konventionelle, offene Inszenierung, durchaus schön, gelungen, klug eingestrichen. Weckherlin akzentuiert das in diesem Stück bei allem Warten und bei aller immer wieder beschworenen Hoffnungslosigkeit vorhandene Reservoir an Zuversicht, Halt und Humor. Abzulesen schon an der Wahl der sich für diesen Akzent eignenden Schauspieler.
Obwohl: Welcher Regisseur am LTT hätte nicht Andreas Guglielmetti und Gilbert Mieroph gewählt? Es sind Paraderollen für die beiden. Jedes Stiefelausziehen wird zelebriert, dass es eine Freude ist. Jeder Streit ist nur der Anlass für die nächste freundschaftliche Umarmung. Und wenn sie sich am Ende vornehmen, morgen mit einem besseren Strick zum Erhängen zurückzukehren, sind wir uns sicher, dass sie ihn vergessen werden oder er wieder reißen wird oder sie plötzlich keinen Baum mehr finden, an dem man es machen könnte. Diese beiden Typen sind wunderbar aufgehoben in ihrer Welt des Nichtaufgehobenseins.
Es mag darin zum Ausdruck kommen, dass dieses Stück heute niemanden mehr schreckt und sich (Deutschunterricht ausgenommen) keiner mehr ernsthaft die Frage stellt, die in den 50er Jahren lebhaft diskutiert wurde, nämlich: Wer dieser Godot denn nun sei. Und zwar nicht, weil sie jemals beantwortet werden könnte. Sondern weil das Psychogramm, das dieses Stück samt Frage grundiert, längst seinen festen Platz im heutigen Bewusstsein gefunden hat. „Warten auf Godot“ ist der Klassiker, der es repräsentiert.
Beckett war einer der ersten, dem konsequent klar war, dass 1) letztlich alles nur konkret das ist, was es ist, sich keine unserer Deutungen hält und 2) die Vorstellung einer bedeutungslosen Konkretion selbst der größte Unsinn ist, weil sich uns grundsätzlich alles mit Bedeutung auflädt. Seine Stücke balanzieren auf dieser Schnittstelle, die er über die Jahre immer schmäler zu gestalten versuchte.
Lässt sich wenigstens diese Deutung halten? Nein, sie lässt sich nicht einmal wirklich verstehen. Eben! Auch weil sich unter solchen Voraussetzungen Sinn und Unsinn gefährlich annähern, kommt es zu Luckys dadaistischem Wissenschaftswahnsinnsmonologsalat, den Stephan Weber zum Besten gibt, ein Abräumer! Ebenfalls beeindruckend Rolf Kindermann als Pozzo. Herr und Knecht? Mensch und Untermensch? Überich und Es? Geist und Körper? Mensch und Natur? Diese dualistische Welt, das Beherrschungs- und Abhängigkeitsprinzip hat am Schluss sichtbar fertig, blind und stumm stolpern sie ihrem Ende entgegen.
Estragon und Wladimir aber, so scheint es, haben ein Schlupfloch gefunden, in dem Karenz gewährt wird, Aufschub. Bis in einigen Jahrzehnten der Klimatod kommt. Ja, entschuldigung, hat mit dieser Inszenierung nichts zu tun, aber solche Assoziationen kann man heutzutage ja mal haben.
Generalanzeiger Reutlingen, 30. September 2019
Zwei Rabbiner und ein Yogabäumchen
(von Thomas Morawitzky)
Regisseur Thorsten Weckherlin gewinnt am LTT Samuel Becketts »Warten auf Godot« behutsam neue Seiten ab
(...) »Warten auf Godot«, der vermeintlich totgespielte Klassiker des absurden Theaters, wird am LTT mit wunderbarer Spielfreude zu neuem Leben erweckt, grotesk, komisch, tragisch, hintersinnig, voller Slapstick, Tiefe und Gefühl. (...)