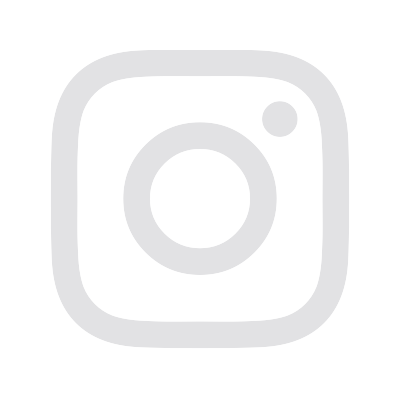Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.




















Nach dem Roman von Ágota Kristóf · 16+
Schwäbisches Tagblatt, 14. Februar 2024
(von Peter Ertle)
Ágota Kristófs „Das große Heft“ ist das düsterste Stück seit langem am Landestheater – ein zeitlos anklagender Kommentar zu Krieg, sexualisierter Gewalt und Kinderschicksalen, die man niemandem wünscht.
Es heißt, es gebe derzeit eine wachsende Zahl von Menschen, die keine Nachrichten mehr anschauen. Nicht als Weltflucht, sondern aus Gründen des Selbstwohls. Demnach wäre keine gute Zeit für diese Inszenierung. Oder ist es etwas anderes, wenn man es als Theaterstück in einer allgemeingültigen Stoffbehandlung sieht? Den Krieg und die Verwahrlosung, nicht zuletzt der Kinder.
Zwei Zwillingsbrüder, 9 Jahre alt, die Mutter bringt sie im Krieg zu ihrer eigenen Mutter aufs Land, zur Großmutter der beiden, so ist das in Ágota Kristófs 1986 erschienenem Roman und in dieser LTT-Romanadaption. Welcher Krieg? Wird nicht konkret verortet. Kristóf selbst, 1933 in Ungarn geboren, wurde gegen Ende des 2. Weltkriegs zu ihrem Bruder gebracht. Aber Krieg und Flucht und der Versuch, Kinder in Sicherheit zu bringen, ist ein universelles Motiv.
Hier, in diesem Stück, beginnt für die Kinder eine Hölle, die mit der bösen Großmutter beginnt und durch zahlreiche Stationen der Abstrafung, vor allem des sexuellen Missbrauchs führen. Und gegen die sie sich mit Eintragungen ihrer Erlebnisse in ein großes Heft wehren. Und mit Abhärtung. Bloß nichts mehr spüren. Die Härte und Grausamkeit macht sie früh erwachsen, falsch erwachsen, roh, zu Kindermonstern. Obwohl sie gleichzeitig doch etwas von ihrer Unschuld und einem offenbar unzerstörbaren Gerechtigkeitsgefühl behalten. Kindermonsterengel, könnte man sagen.
Auf der Bühne überfällt einen das wie ein monochromes Gemälde, Farbe: Grau, die Anfangsbuchstaben von Grausamkeit. Man möchte es eigentlich nicht sehen. Vielleicht beschäftigt man sich deshalb, aus Gründen der Distanzierung, ab einem bestimmten Zeitpunkt vor allem mit dem hervorragenden Bühnenbild (Martha Pinsker), ein je nach Lichtwechsel sich chamäleonartig veränderndes, hinsichtlich seiner Transparenz stufenweise verstellbares und verschiedene Raumtiefen offenbarendes Gebäude, das mit kleinen Filmen und teils live aufgenommenen Zooms des Schauspiels bestrahlt wird (Video: Aaron Geiger, Uwe Hinkel).
Dem Stück entkommt man trotzdem nicht. Und dass sich die Brüder im Laufe der Zeit gezielt wehren, zu Rächern ihres Schicksals werden, verschafft zwar eine gewisse Genugtuung, allein, das erlittene Leid und Unrecht kann es nicht ungeschehen machen. So überwiegt das Grauen über die auch noch zu Tätern werdenden Kinder. Als ihre Mutter (Emma Schoepe, in drei Rollen sehr präsent), die einzig gute Seele des Stücks, sie gegen Kriegsende wieder holen will, wollen sie nicht mehr mit, so entfremdet sind sie inzwischen. Kühl und nebenhin präsentiert wie alles hier – aber die herzzerreißendste Szene.
Einmal sitzen die Zwillinge nur nebeneinander da, es beginnt zu schneien. Kein Geschehen auf der Bühne, kein Wort, eine geschlagene Minute lang. Oder waren es zwei? Nichts, nur: Schneefall. Zeit, die nicht vergeht. Stille Nacht, vermaledeite Nacht, die Welt ein Stück faul Holz. Wenigstens haben sie noch sich.
Regisseurin Sophia Aurich lässt Insa Jebens und Lucas Riedle als verlorene Brüder nicht psychologisch spielen, sondern wie Funktionierende, im Notstrom- und Überlebensmodus (Re-)Agierende, abgestumpft, aber doch versehen mit einer Art Restneugier, wenn sie ihrer Großmutter bei der Flasche Wein am Küchentisch zusehen oder die interessanten Spiele der auf den Hund gekommenen Nachbarstochter Hasenscharte.
Ein Verdienst dieser Inszenierung liegt darin, in der Darstellung der Gewalt schonungslos, aber nicht voyeuristisch zu sein. Die Spitze sichtbarer Gewalt ist eine Szene Waterboarding, weniger peinigend als der seelische Schmerz, Jonas Hellenkämper gibt hier den einzigen Nur-Bösewicht. Doch als größten Voyeurismus leistet sich die Inszenierung die groß im Video eingeblendete Freude des die Kinder missbrauchenden Offiziers – also Freude statt Leid, was als besonders unaushaltbar und perfide empfunden werden könnte, tatsächlich aber der Sicht des Romans folgt: Der Offizier, der die beiden Kinder missbraucht, wird eben nicht als Unmensch, sondern als weicher, bedürftiger, irgendwie auch guter und definitiv vom Leben geschlagener Mensch gezeichnet. Andreas Guglielmetti setzt das hervorragend um.
Auch die bellende, böse Großmutter hat in bestimmten Szenen diese Ambivalenz, eine minimal durchblitzende Güte, oder sie erfährt eine Doppelbelichtung als enttäuschte, mit dem Schicksal hadernde Frau, Sabine Weithöner ist hier eindrücklich. Moralisierend ist hier nichts, alles ist, wie es ist, gnadenlos, und trotzdem gibt es, im Zuschauer als Reaktion provoziert, eine klare Solidarität mit den Kindern, einen stets vorhandenen Kompass für richtig und falsch. Realität nicht parteiisch zu verzerren, aber trotzdem Partei zu ergreifen, ist die Stärke dieses mit undressierten Kinderaugen registrierten, aber doch grundempörten, mit dem Schrecken einer Traumabewältigung notierten Stücks.
Am Ende wird das Leid immer massiver, bewegt sich das Grau des Stücks ins Tiefschwarze. Hört das denn gar nicht mehr auf? Muss das jetzt auch noch sein? Wir haben es doch schon verstanden. Wir haben genug davon, denkt man sich als Zuschauer. Überhaupt: Uns reichen doch schon die von Russland verschleppten ukrainischen Kinder, der kleine Palästinenser, der seine Eltern durch einen Raketenangriff verloren hat, die von der Hamas verschleppte israelische Familie in einem Tunnel in Gaza. Und Krieg braucht es dazu gar nicht mal: Uns reichen die jüngsten Veröffentlichungen über den Missbrauch in der Evangelische Kirche.
„Ein Buch kann nie so schlimm sein wie die Wirklichkeit“, hat Ágota Kristóf mal über „Das große Heft“ gesagt. Und dass sie eine Neigung zum Depressiven habe, ihr selbst alles egal sei. „Außer meine Freunde und Kinder“ fügte sie noch hinzu. Da sind sie wieder: die Kinder. Sozusagen ein kleiner Lichtstrahl. Dieses Stück versagt ihn uns. Oder haben wir ihn doch gesehen? Und wo? In der Liebe der Mutter zu ihren Söhnen? In der Selbstlosigkeit des Schusters, der den Zwillingen alles schenkt, was sie wollen? Im Impuls der Geschwister, ihrer Freundin Hasenscharte zu helfen, generell in ihrem nicht totzukriegenden Gefühl für (Un-)Gerechtigkeit?
Man muss schon suchen in diesem dunklen Stück, in dem sich die Wege der beiden Brüder am Ende trennen. Vielleicht hat auch Ágota Kristóf irgendwo im Leben, am Ende einer Krise, ihr damaliges Ich, diese imaginierte Zwillingsschwester, zurückgelassen.
Aber das große Heft hat sie mitgenommen.
Unterm Strich:
Muss man sich das antun? Nein, man muss nicht. Aber es ist zumindest eindrücklich inszeniert, im Sinne der Autorin unerbittlich, moralinfrei, aber klar positioniert. Beweist im Umgang mit der Alltäglichkeit des Schreckens und in der Ambivalenz der Figurenzeichnung ein gutes Händchen – alles inmitten eines spektakulär guten Bühnenbildes.
Schwarzwälder Bote, 14. Februar 2024
Wo die Seelen abstumpfen und total verrohen
(von Christoph Holbein)
Kristófs Roman ist ein Zeugnis gegen den Krieg, ein nüchterner Blick auf die totalitäre Mentalität einer vom Krieg zerrütteten Gesellschaft – akribisch beobachtet. Die Tübinger Inszenierung greift dies beeindruckend klar auf und leistet damit einen wertvollen Beitrag und Anstoß zum so notwendigen Nach- und Umdenken in diesen, unseren so gewaltvollen Zeiten.
Es geht um die große Frage, ob die Menschen in Kriegszeiten ihre Menschlichkeit bewahren können. Und Regisseurin Sophia Aurich zeichnet das düstere Bild, dass eine Mutter, ihre zwei Söhne und die Großmutter auch mit purem Abstumpfen der Spirale der Gewalt nicht entfliehen können. Untermalt mit Videoeinspielungen und Live-Videos entsteht ein Märchen voller Trost- und Hoffnungslosigkeit.
Es bleibt kein Raum für Liebe und Empathie – hinter der Maske verbirgt sich das wahre, grausame Gesicht.
Zu dieser erschreckenden Atmosphäre trägt das düstere, markante Bühnenbild von Martha Pinsker bei, das in seiner kahlen, kalten Nüchternheit keinen Raum für Liebe und Empathie lässt. Die Protagonisten verbergen ihr wahres Gesicht immer wieder hinter aufgesetzten Masken, mit dadurch verzerrter Stimme. Das wirkt makaber und ernüchternd, wenn sie dann die Masken abziehen und fallen lassen. Es sind Getriebene, die rennen, suchen und doch nicht finden.
Das Schauspiel-Ensemble beweist, wie gut es den Text von Kristóf erarbeitet hat, alle artikulieren bestens, reden gekonnt synchron im Duett und zelebrierend die klare Sprache plastisch und eindrücklich. Der Regisseurin gelingt eine bedrückende Inszenierung, die in verstörenden Szenen mündet, wenn sich die Zwillingssöhne in ihren Ritualen abhärten und sich jede Regung austreiben, um dem Schrecken zu widerstehen. Die Figuren haben keine Chance, ihrer Verderbtheit zu entgehen und mutieren zu eiskalten Monstern: „Man muss töten können, wenn es nötig ist.“ Regisseurin Sophia Aurich lebt dies auch in langen stillen Sequenzen aus, in gedehnten Szenen, die den Zuschauer in Beschlag nehmen, fesseln, aber auch die Gefahr der Langatmigkeit bergen. Die Verzweiflung der Menschen ist in ihrer Körperlichkeit ausgedrückt. Das provoziert starke Bilder, die eindrucksvoll und vielsagend sind – und verstörend zugleich.
Die kongeniale Musik vertieft das authentische Erlebnis auf der Bühne und lässt uns betroffen zurück.
Die Verrohrung ist plakativ und authentisch: „Wir nehmen nicht gerne Geschenke an, weil wir nicht gerne Danke sagen.“ Die Gewalt ist allgegenwärtig: „Du sollst nicht töten – und alle Welt tötet.“ Und sie ist dramatisiert durch die kongeniale Musik, für die Friederike Bernhardt verantwortlich zeichnet. Psychisch, physisch und sexuell missbraucht, gedemütigt und gequält entmenschlichen die Zwillingskinder, zeigen keinerlei Regungen in ihren Gesichtern. Das ist unheimlich, dämonisch und provoziert extreme Szenen und Bilder voller Brutalität. Kristófs Roman ist ein Zeugnis gegen den Krieg, ein nüchterner Blick auf die totalitäre Mentalität einer vom Krieg zerrütteten Gesellschaft – akribisch beobachtet. Die Tübinger Inszenierung greift dies beeindruckend klar auf und leistet damit einen wertvollen Beitrag und Anstoß zum so notwendigen Nach- und Umdenken in diesen, unseren so gewaltvollen Zeiten.
Reutlinger General-Anzeiger, 12. Februar 2024
(von Armin Knauer)
Wie verändern grausame Zeiten die Menschen? Das fragt das LTT mit Ágota Kristófs Roman »Das große Heft«
Anfangs wirken sie zuckersüß in ihren roten Pullovern, wie sie am Bühnenrand mit Puppen spielen. Doch bald schon verschwinden die Puppen unter einem Erdhaufen, und die niedlichen blonden Zwillinge werden zu gnadenlosen Beobachtern einer vom Krieg verstümmelten Welt. Einen verstörenden Roman hat das LTT mit Ágota Kristófs »Das große Heft« auf die Bühne gebracht.
Ein Stoff, der brandaktuell ist in Zeiten, da überall Kriege aufflammen. Gestochen scharf und schonungslos kommt auch im LTT zur Sprache, was das mit Menschen und mit der Gesellschaft macht. Und dennoch wird es in der Regie von Sophia Aurich keineswegs ein depressiver Abend. Mit geballtem Videoeinsatz rückt die Inszenierung den Personen buchstäblich auf die Haut.
Insa Jebens und Lucas Riedle sind die namenlosen Zwillinge. Dass sie entgegen der Vorlage beide Geschlechter abdecken und dass sie grundsätzlich im Chor sprechen, macht klar, dass sie hier nicht nur als Individuen gemeint sind. Sie sind der Spiegel, in dem sich die Grausamkeiten ihrer Umwelt reflektieren; sie sind die kühl beobachtenden Berichterstatter.
Von ihrer Mutter aus der bombardierten Großstadt gerettet und bei der Großmutter am Rande einer Kleinstadt abgeladen, lernen sie schnell, dass sie sich abhärten müssen, um zu überleben. Sie schlagen sich gegenseitig, um gegen die Schläge der Großmutter unempfindlich zu werden. Sie setzen sich Kälte und Hunger aus, um beides nicht mehr zu spüren. Sie schlachten Hühner, um sich an das Töten zu gewöhnen. Ihre Erlebnisse notieren sie in Aufsätzen. Nur die »wahrhaftigen« werden in ein großes Heft abgeschrieben.
Notiert wird unbestechlich, genau, ohne jedes Gefühl. Der Alltag mit der derben Großmutter, die Übergriffe des Pfarrers, der Tod eines Deserteur. Deportationen, Kriegsverbrechen, Sexualität, Grausamkeit. Die Zwillinge notieren alles ungerührt, referieren sachlich und penibel. Und sie handeln selbst, nach ihren eigenen Maßstäben, die oft grausam scheinen – und doch immer wieder Menschlichkeit aufblitzen lassen.
Bühnenbildnerin Martha Pinsker stellt das Haus der Großmutter aus halb durchsichtigen Elementen hell und kalt in die Bühnenfinsternis. Die Härte und der Schmutz einer Welt, in der jeder nur mit dem Überleben beschäftigt ist, vermittelt sich darin. Ebenso, dass dieses Haus wie alles andere für die forschenden Augen der Zwillinge durchsichtig ist. Nichts entgeht ihnen, jedes Detail berichten sie.
Zudem dienen die halbtransparenten Elemente als Projektionsfläche für Videos. Schmerzhaft dicht geht die Kamera, teils live auf der Bühne, an die Körper der Darsteller heran. So dick der Panzer, den hier jeder um seine Emotionen legt, so gnadenlos durchbricht die Kamera die Flucht in die Distanz. Ein Erdhaufen am Bühnenrand steht für begrabene Träume.
So erlebt man Charaktere, die sich in eine Trutzburg der Gefühlskälte zurückgezogen haben – und unter diesem Panzer die Sehnsucht nach Wärme ahnen lassen. Sie setzen das auf der Bühne eindringlich um: Sabine Weithöner als schroffe Großmutter, die ihre Enkel nur »Hundesöhne« nennt. Emma Schoepe als Mutter, als Bettlerin und lüsterne Pfarrersmagd. Andreas Guglielmetti als kriegsmüder Offizier, der sich in masochistische Fantasien flüchtet, als korrupter Pfarrer, als verfolgter Schuster und verzweifelter Vater. Jonas Hellenkemper als lebenshungriger Adjutant, sadistischer Kommissar und erschöpfter Deserteur.
Sie alle spielen das sehr körperlich. Allen voran Insa Jebens und Lucas Riedle als Zwillinge, die in ihrer ungerührten Klarsichtigkeit zeitweise fast monströs wirken. Und andererseits als letzte Instanz von Gerechtigkeit in einer korrupten Welt. Alles scheint an ihnen abzuprallen. Und doch schleppen auch sie die Erde hin und her, unter denen sie ihre Träume begraben haben.
Die Inszenierung von Sophia Aurich packt das in einen Reigen dunkler, eindrücklicher Bilder. Getragen werden sie von elektronischen Klängen, mal ätherisch schwebend, mal poppig pulsierend (Musik: Friederike Bernhardt). Ein Bilderreigen, der das Dunkle, Beklemmende, Grausame dieser Welt transportiert. Aber auch Momente lakonischer Komik. Und solche, in denen die Möglichkeit von Menschlichkeit durchschimmert. Ein beklemmender, bildstarker, dabei durchaus kurzweiliger Theaterabend.