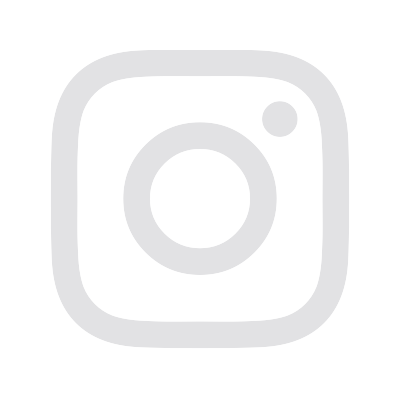Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.










Nach einer Vorlage von Rainer Werner Fassbinder
Schwarzwälder Bote, 26. Februar 2019
„Davon geht die Welt nicht unter“
(von Christoph Holbein)
„Die Ehe der Maria Braun“ am LTT / Zwischen Liebe und Emanzipation
Das Melodram einer großen Liebe und die Emanzipationsgeschichte einer Frau im Nachkriegsdeutschland auf die Bühne zu bringen, ist eine Herkulesaufgabe. Wenn es sich dabei um die theatralische Inszenierung einer weltberühmten Vorlage handelt, läuft das Projekt Gefahr, im zwangsläufigen Vergleich des Zuschauers mit dem Original bei diesem Wandern auf äußerst schmalem Grat abzustürzen.
Regisseur Christoph Roos gelingt es mit seiner Arbeit zu „Die Ehe der Maria Braun“ entlang des Drehbuchs von Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich am Landestheater Württemberg Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT) auf dem Pfad zu bleiben. Auch weil er versucht, für die Geschichte nach einem Film von Rainer Werner Fassbinder trotz allen Anlehnens an das cineastische Werk eine eigene Sprache zu finden und die Aussage mit den Mitteln des Theaters zu übersetzen.
Und das ist gut so, denn mit den schnellen Schnitten und intensiven Nahaufnahmen des Films kann das Theater nicht konkurrieren. Das kann es nicht leisten, aber es kann mit plakativen Bildern punkten, etwa wenn am Anfang des Stücks die aus grauen Bausteinen aufgebaute Videoleinwand, auf der gerade noch die letzten Szenen der Hochzeit von Hermann und Maria Braun zu sehen sind, unter dem Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs mit lautem Getöse eindrucksvoll in sich zusammenstürzt und sich zur Nachkriegs-Trümmerlandschaft verwandelt.
Diese grauen Quader als tragendes Element des Bühnenbilds von Peter Scior, die immer wieder dramaturgisch eingesetzte Heile-Welt-Schlager-Musik - „Nach Regen scheint Sonne“ - und der eingestreute skurrile Witz bilden das Fundament einer stringenten Inszenierung, in der Lisan Lantin als Maria Braun schauspielerisch und sprachlich klar dargestellt den Dreh- und Angelpunkt bildet. Um sie herum bauen, räumen und stapeln die Protagonisten auf der Drehbühne gut choreografiert und mit flottem Tempo schöne Szenen. Das ist glaubhaft, aber nicht immer wirklich tiefgehend, weshalb manches in seiner Wirkung etwas kurz gerät, an der Oberfläche bleibt und fragmentarisch wirkt. Was wiederum mit Fassbinders Film korrespondiert, der auch kaum Inneneinsichten in die Figuren gewährt, knapp erzählt und Handlungsmotive und psychologische Erklärungen mitunter ausspart.
Doch „davon geht die Welt nicht unter“ - und die Inszenierung schon gar nicht, weil das Ensemble detailliert spielt, den Raum passend aufteilt und Regisseur Roos die Personen gut aufstellt und treffend Wechsel setzt. In dieser „schlechten Zeit für Gefühle“ schöpft er die Vorlage aus, um die Figuren zu zeichnen, auch in ihren Illusionen und Träumen: „Ich hab' mich gemacht. Das gefällt mir.“
Und am Schluss gelingt es Maria Braun nicht - trotz allem Zynismus, trotz aller Karriere, trotz allen Vorgehens, ihre Gefühle pragmatisch, kalt und ökonomisch einzusetzen -, das Ideal zu verwirklichen, dass Frauen Männern ebenbürtig sind, sondern ist notariell beglaubigt das Tauschobjekt der beiden Männer, die ihr am nächsten stehen. So endet alles, muss vielleicht so enden, im Schatten der Hochhaus-Wirtschaftswunder-Silhouette in einer großen Explosion.
Reutlinger Nachrichten, 13. Februar 2019
(von Christina Hölz)
Der Krieg panzert seine Überlebenden – blutleer bleiben die Kinder des Wirtschaftswunders zurück: Christoph Roos inszeniert „Die Ehe der Maria Braun“ am LTT. Ein Kammerspiel mit eigener Lesart
Liebesglück im Schnelldurchlauf. Ein Brautpaar flaniert turtelnd den Mittelgang der Tübinger Stiftskirche entlang, tauscht Küsse und Zärtlichkeiten aus. Dann plötzlich brechen die Bilder auf der riesigen Leinwand flimmernd ab, wir hören Fliegerlärm, Trümmer stürzen auf die Bühne. Was der Film an technischem Vorsprung hat, das macht Regisseur Christoph Roos clever wett: Das Landestheater Tübingen inszeniert „Die Ehe der Maria Braun“ nach dem Kinohit von Rainer Werner Fassbinder. Und, das gleich vorab, nicht nur der Einstieg mit bewegten Schwarz-Weiß-Bildern ist stark. Bei Fassbinder fallen Bomben aufs Standesamt, während Maria und Hermann heiraten – bei Christoph Roos und Bühnenbildner Peter Scior blickt das Publikum unmittelbar in die Ruinen der Nachkriegszeit.
Es ist dieses Ruinenland, dieser Trümmerhaufen, der sich metaphorisch durch den ganzen Theaterabend zieht. Nicht nur die deutschen Städte liegen in Schutt und Asche nach dem Zweiten Weltkrieg. Zerrüttet ist auch das Seelenleben der Generation Wiederaufbau. Gefühlskalt und innerlich leer sind die Protagonisten, bei Roos fast noch mehr als bei Fassbinder.
Für die vom Glück Betrogenen steht Maria Braun wie keine andere. Ihr Mann Hermann muss unmittelbar nach der Hochzeit an die Front ausrücken und kommt nach 1945 nicht zurück. Anfangs steht Maria noch täglich mit ihrem Suchschild am Bahnhof und wartet auf den Einen. Als ihr ein Heimkehrer – fälschlicherweise – von Hermanns Tod berichtet, stürzt sie sich in eine Affäre mit einem US-Soldaten, der sie auch mit Nylonstrümpfen und Zigaretten versorgt.
Die beiden sind gerade einmal wieder im Bett zugange, da erwischt sie der zurückgekehrte Hermann in flagranti. Beim folgenden Gerangel erschlägt Maria den GI. Die Schuld nimmt Hermann auf sich, er geht für sie ins Gefängnis.
Im Jahr 1978 landete Regie-Workaholic Rainer Werner Fassbinder, das Enfant terrible des neuen deutschen Films, mit „Die Ehe der Maria Braun“ seinen größten kommerziellen Erfolg. Für Hauptdarstellerin Hanna Schygulla, an ihrer Seite spielte Klaus Löwitsch, markierte der Streifen den großen Durchbruch. Er habe einen Film über das Leben seiner Eltern drehen wollen, sagte Fassbinder damals. Über die verlorenen Kinder des Wirtschaftswunders, die das Verdrängen und Funktionieren zur Lebensaufgabe machten.
Siehe die Tübinger LTT-Inszenierung: Während sich die Akteure ans Aufräumen machen – und die Trümmer auf der Bühne immer mehr kleinen Papp-Hochhäusern weichen – tönen 50er-Jahre-Schlager aus dem Off: „Wir werden das Kind schon schaukeln“, „Auf Regen folgt Sonne“ oder „Davon geht die Welt nicht unter“.
Der heimelige Unterton des damaligen Heimatfilms fehlt komplett, und das nicht ohne Grund. Maria Braun, die eigentlich nichts anderes als ein Leben mit ihrem Hermann wollte, geht für eine bessere Zukunft über Leichen.
Es ist nicht allein der Mord an dem amerikanischen Soldaten, den sie auf der Bühne (anders als im Film) mit einer Pistole erschießt. Es ist dieses ganze zweckmäßige Kalkül, mit dem Maria versucht, einen verlorenen Traum zu retten. Dass bei Roos trotz aller Dramatik alles Schrille und Laute fehlt, zählt zu den Stärken der Inszenierung. Das Stück ist über weite Strecken Kammerspiel.
Geradezu maschinenhaft-kalt geht Maria-Darstellerin Lisan Lantin zur Sache, um finanziell aufzusteigen. Ja, den Strumpfabrikanten Karl Oswald (Rolf Kindermann horcht seine Rolle feinsinnig aus) verführt Lantins Maria so blasiert-hochnäsig, dass man sie am liebsten schütteln will. Spätestens jetzt ist jegliche Naivität passé. Eine bedingungslose Liebende, die wartende Ehefrau? Nicht bei Lantin, die gibt längst die Abgeklärtheit in Person.
Ganz im Gegenteil zu Marias Freundin Betty übrigens (Mattea Cavic gefällt gleich in vier Rollen), die lieber Kartoffelsalat anrührt als Karriere zu machen. Doch Maria, die „Mata Hari des Wirtschschaftswunders“, hat am Ende rein gar nichts von ihrem nassforschem Vorwärtskommando. Nachdem Hermann (Daniel Holzberg) entlassen wurde, erfährt sie, dass sie das Heft nie selbst in der Hand hatte. Die Männer haben längst über sie verhandelt. Statt um Romantik geht es am Ende um Abhängigkeit – Maria ist nur Vertragsgegenstand und wird regelrecht verkauft.
Wie Christoph Roos das Drama auflöst, sei hier nicht en détail verraten. Nur so viel: Während Fassbinder offenlässt, ob Maria ihr Eigenheim absichtlich in die Luft sprengt, hat sich die Tübinger Inszenierung entschieden. Auch der Schluss verdient ein Ausrufezeichen.
Schwäbisches Tagblatt, 11. Februar 2019
Eine Frau, die sich gemacht hat
(von Peter Ertle)
Christoph Roos, Experte für Filmadaptionen, macht am LTT aus dem Drehbuch von Rainer Werner Fassbinders international erfolgreicher Deutschland-Allegorie "Die Ehe der Maria Braun" einen sehr schönen Theaterabend.
Man sieht sie lange, bevor es losgeht auf einer "Leinwand", so gesehen eine kleine Reverenz an den Film: Maria und Hermann, in slow motion, tiefe Blicke, Küsse, like lovers do. Schließlich als Brautpaar, aus der Stiftskirche tretend. Was dann passiert, lassen wir mal genauso aus wie das Ende, man soll dem Zuschauer ja etwas Spannung gönnen.
Sagen wir so: In Fassbinders Film wird das Standesamt bombardiert. Und auch hier liegen bald Trümmer auf der Bühne. Aus denen allmählich eine Großstadtlandschaft mit Bürotürmen emporwächst. Eine genial einfache, sinnbildliche Bühnensprache (Bühne: Peter Scior) für das Nachkriegswirtschaftswunder, das wir nun besichtigen, indem wir eine Figur begleiten.
Maria Braun, gerade noch glückliche Braut, jetzt Trümmerfrau, mit der Suchanzeige ihres im Krieg gebliebenen Hermanns um den Hals, eine Brosche gegen ein Kleid tauschend, mit dem Kleid Arbeit in einer Bar findend. Den Ehering muss sie abnehmen, die Illusionen der Männer sind geschäftsfördernd. Sie selbst bleibt ehrlich, als sie sich in den GI Bill verliebt, macht ihm nichts vor. Heiraten? Nein. Sie wartet auf Hermann.
So hält sie es auch später in ihrer Beziehung zum Industriellen Oswald, aber hier wird sie schon deutlicher, die Problematik einer Frau, die zwischen privat und geschäftlich, zwischen Disziplin und Emotion so zu trennen versucht wie zwischen Jetztverliebtheit und einem aufgeschobenen Eheglück, von dem wir nicht wissen, ob es noch die große Liebe oder nur noch die Erinnerung daran ist, Gefühl gewordene gesellschaftliche Konvention, vielleicht beides, jedenfalls: Festgehaltene Utopie.
Nun sind Instrumentalisierung, Disziplinierung, kaufen und verkaufen, Bereiche trennen können, Emotionen einsetzen das A und O jedes Geschäftslebens. Dass eine Frau es erfolgreich in Anspruch nimmt, macht "Die Ehe der Maria Braun" auch zu einer (letztlich dann doch scheiternden) Emanzipationsgeschichte.
Marias große Illusion ist, zu glauben, dass sie bei alledem souverän und ohne Beschädigung selbst an den Hebeln sitzen kann. Weshalb am Ende auch sehr die Frage ist, ob sie wirklich in erster Linie an der Desillusionierung ihres großen Liebestraums verzweifelt. Oder nicht eher an der Erkenntnis, dass just die beiden von ihr geliebten Männer über sie, die die Fäden in der Hand zu halten glaubte, verfügten. Oder zerbricht sie einfach, weil sie ihre Seele verkauft hat?
Lisan Lantin spielt Maria Braun mit einem treffenden Mix aus Unverstelltheit und einer Berechnung, die im Verlauf des Stücks immer programmatischere Züge annimmt.
Wenn sie ihren Oswald ins Bett lotst, danach aber wieder lieber zum Sie übergeht, wirkt sogar die kokette Verliebtheit in die eigene Frechheit wie spielerischer Überschuss, sexy - obwohl sie auch als Verstörung (ablesbar in Oswalds Gesicht) und überkecke Kaschierung einer Not verstanden werden kann. Da gelangen den Drehbuchschreibern Pea Fröhlich und Peter Märtesheimer (Fassbinder lieferte nur das Exposé und strich dann an der Textfassung) wunderbar ambivalente und mit wenigen Worten verflixt gut geschriebene Sequenzen, die einem Ödon von Horvath zur Ehre gereicht hätten, die man in den Boulevard genauso wie in ein Brechtsches Lehrstück verlängern könnte.
Wenn Lantins Maria erst auf die (fälschliche) Nachricht von Hermanns Tod und dann auf die Nachricht vom Tod ihres späteren Liebhabers Oswald reagiert, meint man im fein nuancierten Schmerz schon die ganze, sich ändernde Beziehungsdynamik zu sehen. Derweil wächst um Maria herum etwas, das der Frankfurter Bankenskyline ähnelt, wird sie zunehmend zu einer genervt kommandierenden Zynikerin.
Die Verwandlung hat ihre Stationen, von Christoph Roos, dem Szenenkopplungsmeister, in Form eleganter Übergänge und harter Cuts präsentiert. Hatte die Liebe zum GI Bill zumindest für den Zuschauer noch jene naivverträumten Züge, die ihr nur die Polizei beim Verhör abspricht, hat Marias gezieltes Aufsuchen des Zugabteils, in dem der reiche Industrielle Oswald sitzt, bereits klar karrieristische Züge: eine Frau will nach oben.
Auch mit welchen Mitteln sie den Verhandlungspartner der amerikanischen Firma zum Geschäftsabschluss bringen will, lässt die Inszenierung im Munkeldunkeln des Szene-Offs. Eins ist klar: Längst instrumentalisiert und verkauft sich Frau Braun. Auch privat ist es mit ihrer Ehrlichkeit nicht mehr so weit her: Von Hermann erzählt sie Oswald lieber nichts. (Kurz vor Oswalds Tod sitzt Maria mit ihm an einer unglaublich langen Tafel, beide an den Kopfenden: Distanz. Manchmal sind Theaterbilder so einfach - und genial.)
Fassbinder selbst hat den bewussten Selbstmord Marias, den seine Drehbuchschreiber vorhatten, zu einem zwischen Unfall und Suizid interpretierbaren Unglück umgeschrieben, die Dialoge für den Film gekürzt und mit interpretierbaren Leerstellen versehen. Regisseur Christoph Roos geht diesen Weg weiter, es gibt eher noch mehr im Vagen Gelassenes. War im Film das Liebesverhältnis mit Oswald nicht offenkundig nahegelegte Einstellungsbedingung des Industriellen? Wir glauben uns zumindest so daran zu erinnern, obwohl wir es genauso hielten wie die Hauptdarstellerin, die den Film vorher explizit nicht mehr anschaute, um frei davon zu sein.
Im LTT jedenfalls ist Karl Oswald zwar sichtlich interessiert an Maria, aber frei von direkten Avancen, ein sehr anständiger, von Rolf Kindermann gewohnt souverän und mit feinsten Regungen gespielter Geschäftsmann. Neben dem Protagonistentrio überzeugen alle anderen Schauspieler in Mehrfachrollen. Mattea Cavic glänzt vor allem als Betti und Frau Ehmke, zwei sehr wiedererkennbare Typen. Andreas Guglielmettis Arzt geht einem zu Herzen, genauso vom Leben gezeichnet wie Daniel Holzbergs Hermann Braun. Ja, wenn man etwas von den Kriegsbeschädigungen sehen möchte, blicke man in die Gesichter des Arztes und des Ehemanns!
Möchte man etwas von den Alltagsbeschädigungen sehen, schaue man hingegen ins Gesicht von Stephan Webers Willi Klenze, wenn er über seine Frau spricht. Susanne Weckerles Mutter und Dennis Junge als ihr Freund stehen für das fröhlich durchwurstelnde Leben zwischendrin. "Davon geht die Welt nicht unter" singt das Ensemble und dass sie das Kind schon schaukeln werden. Die Lieder sind so eingebaut, dass sie keinen gutgelaunten Musicaltouch verbreiten. Überhaupt ist dem Regisseur alles kontrastierend Plakative fern. Wenn Fassbinder sein Paar sterben lässt, während im Radio "Deutschland ist Weltmeister!" dröhnt, ist das ja schon ziemlich dicke. Kommt nicht in Frage im LTT-Kammerton, wo kein Film nachgespielt wird und keine Hollywood-tauglichen Bilder inszeniert werden. Ein klug und dezent in Szene gesetztes Drehbuch, das ist es. Und absolut sehenswert.
Unterm Strich
Bei einem Hauptdarstellerpaar aus Lisan Lantin und Rolf Kindermann müsste ein Regisseur viel falsch machen, um die Inszenierung zu ruinieren. Christoph Roos macht im Gegenteil viel richtig, indem er ein genau gebautes, eher zurückhaltendes Kammerspiel inszeniert, in dem alle Schauspieler Raum für die Entfaltung ihrer vielen Rollen bekommen. Tolle Bilder, ein Wahnsinnsauftakt, ein Schluss wie ein Schuss.
Reutlinger General-Anzeiger, 11. Februar 2019
(von Monique Cantré)
Das LTT zeigt Rainer Werner Fassbinders Kinoklassiker in einer Bühnenfassung
Mit einem starken Einstieg eröffnen Regisseur Christoph Roos und Bühnenbildner Peter Scior ›Die Ehe der Maria Braun‹ im LTT: Auf großer Video-Leinwand schreitet das Hochzeitspaar Maria und Hermann durch die Tübinger Stiftskirche, als plötzlich Kriegslärm dröhnt und Bomben die Kulisse mit Getöse einstürzen lassen.
Die Emanzipationsthematik der 1970er-Jahre ist in dem Melodram so hitzig in die Nachkriegsverwerfungen gepackt, dass die extreme Handlung zeitlos Interesse weckt, weil es sich lohnt, den Gefühlen der Figuren nachzuspüren.