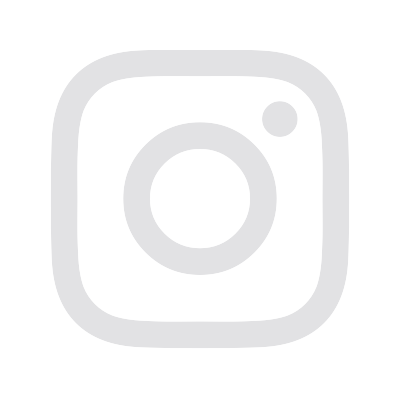Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.









Schauspiel nach dem Roman von Friedrich Hölderlin
Schwarzwälder Bote, 7. Oktober 2020
Verfangen in symbolträchtigen Bildern
(von Christoph Holbein)
"interessant, aber auch anstrengend, vergeistigt und in gewisser Weise kontemplativ."
Tübingen. Friedrich Hölderlins Roman »Hyperion« ist mit Sicherheit schon als Lesestoff keine leichte literarische Kost. Das Werk – der Autor hat es als Briefroman konzipiert – als Schauspiel auf die Theaterbühne zu bringen, stellt deshalb eine Herausforderung der besonderen Art dar. Regisseurin Carina Riedl hat dieses Wagnis auf sich genommen mit ihrer Inszenierung in der Werkstatt des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT), zu der sie auch die Bühnenfassung liefert. Das zeugt von Mut, möglicherweise auch gegen den Strich der Sehgewohnheiten des Publikums zu bürsten und den Zuschauern die intellektuelle Last der Interpretation des Gesehenen aufzubürden.
Denn, wer einen Theaterabend erwartet hatte mit Figuren, die sich im Laufe des Geschehens entwickeln, die miteinander interagieren, der sah sich enttäuscht und quälte sich womöglich durch die fast zwei Stunden der Aufführung. Wer sich aber darauf einließ, dass Theater alles ausprobieren darf, ein Freiraum darstellt, alle Formen zu nutzen und mit ihnen zu experimentieren, der gewann dem Abend zumindest ab, sich intensiv auf Hölderlins Text zu konzentrieren, ihn wirken zu lassen, und begab sich auf die Suche nach dem Sinn hinter den symbolträchtigen Bildern, die Riedl in Endlosschleifen offeriert.
Das Experimentelle beginnt bereits vor der Aufführung: Die Zuschauer müssen vor Betreten der Theaterwerkstatt ihre Schuhe ausziehen, diese in ein Regal stellen und dann strümpfig über die Bühne zu den rund herum im dunklen Raum verteilten Plätzen gelangen, die ausgewiesen sind durch auf den weißen Kissen liegenden zu Briefen gefalteten Zetteln aus hauchdünnem Papier – beschrieben mit dem Auszug aus einem Gedicht von Friedrich Hölderlin.
Was folgt, ist mehr eine Lesung, denn szenisches Spiel: Die Schauspieler befinden sich fast wie Simultanübersetzer in per transparenten Stoffs einsehbaren Sprecherkabinen, die sich um einen runden Tisch scharen, der in der Mitte des Raumes steht und mit Kassettenrekordern bestückt ist. Pia Greven sorgt für Bühne und Kostüme. Auf dem Rund des Tisches, der später noch zur Drehbühne wird, übersetzt ein Akteur nach dem anderen Hölderlins Worte in jeweils wiederkehrende Bewegungen, während die anderen synchron die Texte dazu gut zelebrieren.
Diese Sequenzen mit ihren jeweils eigenen Bewegungsabfolgen haben ihre Längen, werfen den Zuschauer nach einer Zeit auf den Text zurück, wenn etwa die mit Händen und Armen gebildeten fast balletthaft tänzerischen Figurenbilder oder die asiatischen mit Schrei untermalten Kampfkunst-Zeremonien sich stereotyp wiederholen. Darüber liegen Geräusche, dumpfes Tönen, archetypische Klänge, Musik. Das ist interessant, aber auch anstrengend, ist vergeistigt und in gewisser Weise kontemplativ.
Riedl schafft fast überladene Bilder. Die Schauspieler beherrschen die Texte – ob solo oder im Wechselspiel mit den anderen. Am Ende kommen alle vier Akteure ins Rund, angezogen mit einem Plastiküberzug und lassen die Kassettenrekorder auf dem Tisch abspielen in einer orchestralen Mehrstimmigkeit der Hölderlinschen Worte. Eines ist der Regisseurin auf alle Fälle zu attestieren: An Intensität und Eindringlichkeit mangelt es ihrer Inszenierung wahrlich nicht.
Schwäbisches Tagblatt, 5. Oktober 2020
(von Wilhelm Triebold)
"ein raffinierter Ansatz, der das hochkonzentrierte Zuhören möglich, aber auch nötig macht"
Eigentlich kann man als Theater am „Hyperion“ nur scheitern. Und zwar so gründlich wie Klaus Michael Grüber, der im Dezember 1977 im 85 000 Zuschauer fassenden Westberliner Olympiastadion seine Hölderlin-Sentenzen deklamierenden Akteure sich warmlaufen ließ - vor 800 Zuhörern wohlgemerkt, die von dem fernen, fremden Spektakel da drunten Rund nur wenig mitbekamen. Aber dabei sein ist alles.
Dagegen mutet der Tübinger „Hyperion“, der am Tag der Deutschen Einheit im Landestheater herauskam, fast schon schlüssig an. Das Corona-Feeling vergleichbar wie in Herthas altem Heimstadion, ein Publikums-Häufchen, verteilt über die vielen ansonsten leeren Plätze. Die LTT-Werkstatt fasst bestenfalls 134 Zuschauerinnen und Zuschauer, am Freitag zählten wir 17 belegte Stühle, Kissen oder Hocker – und damit gilt die Premiere offenkundig schon als ausverkauft (oben jedenfalls mussten Spontanbesucher wieder umkehren). Die Corona-Misere, sie schlägt unerbittlich zu.
Carina Riedls Inszenierung scheint aus der Not eine Tugend stricken zu wollen und begreift Hölderlins epische Vorlage gleich mal als epidemiologische Steilvorlage. Wie heißt’s so schön im „Hyperion“: „Der Tod ist ein Bote des Lebens, und dass wir jetzt schlafen in unsern Krankenhäusern, dies zeugt vom nahen gesunden Erwachen.“
Das geht schon los, bevor man maskenbewehrt in Pia Grevens heilig-nüchternen Teppichboden-Parcours tappt. Straßenschuhe bleiben hier absichtsvoll außen vor, und der Bühnenbild-Teppichboden lappt bis ins Entrée. Denn „schon beim Schwellenübertritt soll es möglich sein“, so wünscht es sich Regisseurin Riedl, „den Alltag und seine Routinen zu verlassen und die Panzer, mit denen man sich draußen schützt, abzulegen“.
Das klingt erst einmal arg nach anthroposophisch befeuerter Weihestunde. Die Regisseurin, die am LTT mit Kafkas „Verwandlung“ und Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ bereits zwei Erzähltexte, mal mehr und mal minder erfolgreich, als kollektive Theater-Annäherung adaptiert hatte, widersteht nun allerdings der allzu großen Versuchung, Hölderlins einzigen (Brief-)Roman als hehre Deklamationsveranstaltung anzubieten, hier aufgeteilt auf vier Sprechrollen.
Hölderlins „Hyperion“ ist in Riedls Lesart ein andauernder Verinnerlichungs-, Vereinzelungs- und Verzweiflungsprozess. Die Wörter zerfallen dem Sprechquartett im durchscheinenden Pavillon-Kokon ihrer Aufenthaltskabinen sowohl zu Anfang als auch am Ende beinahe wie die berühmten modrigen Pilze in Hofmannsthals berühmten Chandos-Brief. Und nur die anstrengende, aber auch anregende Gedächtnisleistung des Einzelnen setzt sie zur neuen Poetik ganz im Sinne Hölderlin zusammen.
Es gibt Sätze, die reinigen mehr als jedes Hygienekonzept. „Das macht uns arm bei allem Reichtum, dass wir nicht allein sein können“, wird Hölderlin herbeizitiert. Oder: „Es ist auf Erden alles unvollkommen, ist das alte Lied der Deutschen. Wenn doch einmal diesen Gottverlassnen einer sagte, dass bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines unverdorben, nichts Heiliges unbetastet lassen mit den plumpen Händen.“ Es ist wiederum ein raffinierter Ansatz, der das hochkonzentrierte Zuhören möglich, aber auch nötig macht, den das Kleeblatt aus ihren vier Eremitenklausen auch einfordert.
Davon kann auch allerlei störendes akustisches Beiwerk nur schwer ablenken: Der Text zieht einen unwillkürlich in den Bann. Mitunter am besten, wenn man im Halbdunkel des Bühnenraumes die Augen schließt, um die Ohren besser aufzusperren.
Denn szenisch ist der Regie nur mäßig etwas eingefallen. Hyperions (und somit auch ein bisschen Hölderlins) Etappenweg über die schwärmerische Adoleszenz, das Anhimmeln der Diotima-Liebschaft und der Busenfreunde, das verquast-verquere Kriegsgeschrei inklusive Griechensehnsucht und schließlich das resignative Verdämmern unter den barbarischen Deutschen wird durch einen eher kruden Zeitlupen- oder Wiederholungsaktionismus aufgepeppt.
[...]
Eine Inszenierung sollte verdeutlichen und nicht ablenken, nicht in die Irre führen, nicht den Gehalt in verirrte Bilder und Aktivitäten übersetzen. Hölderlins Wortmusik oder das, was die Fassung für die eindreiviertel Stunden in der Werkstatt von ihr übrig lassen kann, erweist sich dann aber als stark genug, um sich gegen solche Illustrierungsversuche zu behaupten. Das Hyperium schlägt zurück.
[...]
Reutlinger General-Anzeiger, 5. Oktober 2020
(von Martin Bernklau)
Carina Riedl bringt Friedrich Hölderlins Briefroman »Hyperion« auf die LTT-Werkstatt-Bühne
Pia Grevens Raum für Friedrich Hölderlins »Hyperion« hat Charisma: Über einen transparenten Tunnel betreten die Besucher (ohne Schuhe) die Tübinger LTT-Werkstatt; aus vier variabel leuchtenden Sprecher-Käfigen sollen die heiligen Worte des hochfliegenden Briefromans erklingen; die Mitte bildet eine Art großer Dance-Table, per Kettenkurbel zum Rotieren gebracht; der Boden ist belegt mit schwarz-weichem Teppich; die weißen Zuschauerkissen, weit hergeholtes Symbol wohl für ganz unbefleckte antiseptische Reinheit zu Corona-Zeiten, leuchten grell im Schwarzlicht.
Prosa-Adaptionen für die Bühne sind ja nach wie vor schwer in Mode. Und Regisseurin Carina Riedl hat am LTT beachtliche Arbeiten zu Texten von Franz Kafka, Wolfgang Herrndorf und Joseph Conrad abgeliefert. Das Problem bei dieser Premiere am Freitagabend aber ist noch deutlicher: Trägt die Parallelwelt von Bildern – Bildern mit Menschen, die zwar was tun, aber nicht handeln oder zumindest übers Schicksal grübeln, wie auf der traditionellen Bühne üblich – irgendetwas zu Verständnis und Vertiefung des Textes bei? In diesem Fall muss die Antwort heißen: Nein, im Gegenteil, sie lenkt wirklich nur ab. Auch der Soundtrack von basslastig wabernden Ton-Clustern, die Lichtregie oder der Bühnenrauch dienen doch eher dem bloßen suggestiven Effekt. Ausnahmsweise mal etwas böse gesagt: Das ist reiner Schein, schicke Oberfläche und sinnfreie Wichtigtuerei.
Die vier Schauspieler Nicolai Gonther, Justin Hibbeler, Hannah Jaitner, Insa Jebens sind, was sie sehr gut machen, auf Sprecher, Pantomimen oder auch nur Kurbler reduziert. Ein bisschen läppisch und durchaus ärgerlich ist dabei die Modemarotte, dass sie – bei den Rollen der Briefschreiber Hyperion, Bellarmin und Diotima – zeitweise konsequent auch noch gegengeschlechtlich eingesetzt werden.
Schon dieses endlos langweilige Ausziehen und Wiedereinhüllen in ein Hoodie zu Beginn ist vom kargen Geschehen in diesem überschwänglich idealistischen Gedankenroman (mit etwas Liebestragik) so weit weg, dass es nicht mal als illustrierendes Bild oder gar als bemühte Allegorie taugt. Eine weibliche Ninja mit Kiai-Kampfschrei, ein eleganter gewandeter Hermaphrodit, der traurige Kurbler? Das ist die reine Versetzung in eine völlig eigene emotionale Welt, die der Text nicht nur bei Carina Riedl – »tatsächlich zu Tränen gerührt« – wie eine halluzinogene Pille aufgerufen haben mag. Mit Hölderlin, dem sprachmagischen Hymniker, und seinem –?formal in jeder Hinsicht völlig missglückten – »Hyperion«-Briefroman hat das kaum noch was zu tun.
Dass diese Inszenierung im Jubiläumsjahr von Hölderlins vibrierend hoher und jenseitiger Sprache nun aber mit ganz eigenmächtigen Bildern geradezu wegführt, anstatt sie fürs Theater irgendwie zu fassen und zugänglich zu machen, das muss diesen Versuch, dieses allzu subjektiv selbstbezogene Experiment, dann doch zwingend scheitern lassen. Das gute Dutzend Zuschauer zu Corona-Zeiten applaudierte aber ausdauernd.
Die deutsche Bühne, 3. Oktober 2020
(von Wilhelm Triebold)
„Hölderlins epischer Klagegesang zieht wohl jeden über die eindreiviertel Stunden Spieldauer hinweg in den Bann.“
Auch die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins hat die Pandemie gehörig durcheinandergerüttelt. Der Dichter, dessen zweite Lebenshälfte im Tübinger Turm mit Neckarblick als Inbegriff des tragischen Eremitendaseins gelten darf, wäre unter vielem anderen vor Ort nicht nur mit einer Hölderlin-Oper („Der Thurm“, ein Uraufführungswerk von Markus Höring) und einem opulenten Hölderlin-Sommertheater der Freilichtspezialisten vom Melchinger Lindenhoftheater gebührend geehrt worden. Und nun: Alles abgeblasen beziehungsweise verschoben. „Weh mir, wo nehm‘ ich, wenn / es Winter ist, die Blumen?“, könnte man mit dem Dichter klagen.
Doch es gibt da noch den „Hyperion“ am Tübinger Landestheater. Regisseurin Carina Riedl, die sich am LTT mit Kafkas „Verwandlung“ und Joseph Conrads „Herz der Finsternis“ bereits als kundige In-Szene-Setzerin von Erzählliteratur erwiesen hat, destilliert aus Hölderlins einzigem (Brief-)Roman eine insgesamt düster dräuende und aufs Gemüt drückende Theaterfassung über einen an sich und der Welt Zweifelnden, letztlich auch Scheiternden.
Dazu muss sich das spärlich zugelassene Publikum erst einmal seines Schuhwerks entledigen und dann auf ausgelegter Teppichware die Bühneninstallation von Pia Greven erwandern. Hölderlins dunkeltrunkener Text ist als grandioser Monomanolog eigentlich denkbar ungeeignet, um bühnen- und rollengerecht zerlegt zu werden. Großschauspieler wie Heinz Bennent oder Jens Harzer liefen mit dem „Hyperion“ im Gepäck zu toller Solo-Form auf – aber taugt solch eine Innerlichkeitsschau nun auch fürs Sprechquartett?
Im LTT wird die Vereinzelung schon dadurch ersichtlich, dass die vier Ensemblemitglieder Hannah Jaitner, Insa Jebens, Nicolai Gonther und Justin Hibbeler zuerst einmal jede(r) für sich in transparente Pavillons verbannt sind. Von dort aus tragen sie ihre Teile zur Sprachpartitur bei, Wortfetzen oder auch ganze Passagen im getragenen Wechselspiel. Darüber hinaus treten sie aber auch nach und nach in das von Kassettenrekordern umkränzte Rund, um auf einer angekurbelten Drehscheibe den armen Hyperion (und mehr noch seine Projektionen) in verschiedenen Formen und Lebensabschnitten darzustellen. Als schwärmerischen Jüngling ebenso wie als desillusioniert Liebenden, als Idealisten oder schließlich auch als still Resignierenden.
Das alles wirkt zwar leicht überinszeniert und übermotiviert, samt verkünstelt-weihevollen Bewegungsübungen mit Anleihen bei Tai Chi und Gebärdensprache. Hannah Jaintner darf von der rotierenden Bühne mitunter ein peitschendes „Ha!“ in den abgedunkelten Raum schleudern und schreckt so die Zuhörer beim Nachlauschen von Hölderlin Wortmusik auf. Und doch: Hölderlins epischer Klagegesang, bei dem die berühmte Deutschen-Schelte nicht fehlen darf („Handwerker siehst du, aber keine Menschen“), zieht wohl jeden über die eindreiviertel Stunden Spieldauer hinweg in den Bann.
Fazit: eine hochambitionierte und letztlich doch mehr hörens- als sehenswerte Inszenierung, der man allerdings auch weiterhin konzentrierte Zuschauer wünschen mag. Im Schlussbild erinnert sie wiederum an die Corona-Misere, die das derzeit bedauerlicherweise erschwert: Die einsamen Vier auf der Bühne, jeweils eingeschlossen in Zellophan-Hüllen oder auch -Höllen. Isolation und Abstand wahren – auch das steckt nun reichlich in diesem düster projizierten Tübinger „Hyperion“.