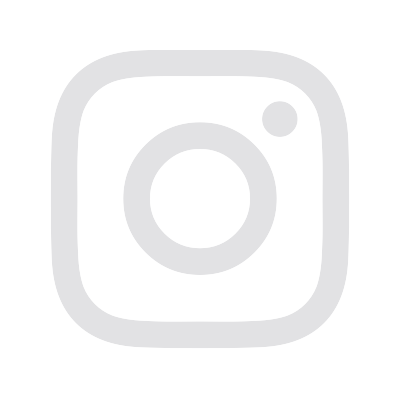Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.











Ein theatraler Gang durch die jüdische Geschichte Tübingens · 14+
Reutlinger General-Anzeiger, 9. Juli 2024
(von Thomas Morawitzky)
Sapir Heller hat für das LTT einen theatralen Spaziergang durch die jüdische Geschichte Tübingens inszeniert
Es beginnt in der Gartenstraße, am Platz der Synagoge. Von dort führt das Landestheater Tübingen (LTT) durch die Tübinger Innenstadt, über Kopfsteinpflaster in Gässchen, und erzählt dabei die Geschichte des jüdischen Lebens in dieser Stadt – eine Geschichte, die von Ausgrenzung, Verfolgung bestimmt ist, lange ehe der Wahnsinn des Nationalsozialismus, der Judenverfolgung auch Tübingen erfasste und schreckliche Dinge geschahen.
»Lebendige Stolpersteine« hat das LTT seinen theatralen Gang genannt und knüpft damit an das Projekt der Stolpersteine an, das der Berliner Künstler Gunter Demnig schon 1992 initiierte, das fortdauert und bei dem Stolpersteine, kleine Tafeln aus Messing, mit Daten versehen, verlegt werden, die an die Opfer des NS-Regimes erinnern, meist nahe bei den Häusern, in denen diese Menschen lebten und arbeiteten. 2023 verlegte Demnig den 100.000. Stolperstein, in Nürnberg.
27?Stolpersteine gibt es allein in Tübingen. Die Teilnehmer am Theaterspaziergang werden manchen von ihnen begegnen, allen zuletzt in der Werkstatt des LTT, in der der Spaziergang endet.
Auf dem Weg dorthin, bei einem Gang durch ein Tübingen, das an diesem Abend glücklich unter einem strahlend blauen Himmel liegt, entsteht ein Bild der jüdischen Kultur, so sehr wie ein Bild des Hasses, den diese Kultur auf sich nehmen musste.
Die Spaziergänger lernen die Geschichten von Menschen kennen, die kämpften, sich wehrten, unterlagen, vertrieben, oft ermordet wurden. Der Förderverein für jüdische Geschichte in Tübingen ist Kooperationspartner des LTT, die israelische Regisseurin Sapir Heller inszenierte – und Franziska Beyer, Dennis Junge, Jennifer Kornprobst, Immanuel Krehl, Stephan Weber, Andreas Guglielmetti und Sabine Weithöner treten auf, führen durch die Stadt, erscheinen als lebendig gewordene Geschichte in den Straßen.
Die Spaziergänger erfahren vom Café Pomona, das als geselliger Ort in Tübingen galt und einer der ersten wurde, der die Juden vom gesellschaftlichen Leben ausschloss. Sie hören von Graf Eberhard im Bart, dessen Namen die Universität Tübingen noch heute trägt und der ein erbitterter Judenhasser war. Sabine Weithöner tritt auf, ganz in Schwarz, und erzählt vom Selbstmord ihres Mannes Jakob: »Er lag schlussendlich tot unter dem Gashahn.«
Zu Beginn des Spaziergangs haben die Teilnehmer je ein Tablet erhalten, mit Ohrhörern versehen; sie können Jahreszahlen als Codes eingeben und erhalten so weitere Informationen, Bilder, Namen, können auch abstimmen – zum Beispiel über die spitze Forderung, im Tübinger Gemeinderat eine Quote von 30 Prozent jüdischer Räte einzuführen. Brücken in die Gegenwart werden geschlagen, zum Konflikt zwischen Israel und Palästina, zum Anwachsen antisemitischer Ressentiments; ein Schauspieler tritt auf als judenfeindlicher Passant, geht wutentbrannt davon.
Und alles führt zuletzt ins LTT, in ein Ambiente der Gastlichkeit, auf einer Bühne, die das Publikum betreten darf, auf der Wohnzimmerlampen stehen, Topfpflanzen, wo Fladenbrot mit Humus serviert wird. Hier hat es Tische, Stühle und jene große Wand, auf der die Bilder aller Menschen zu sehen sind, denen ein Tübinger Stolperstein gewidmet ist, nebst anderen Menschen, die weltberühmt sind und mit den jüdischen Leben verbunden: Albert Einstein, Bob Dylan, Mascha Kaléko, Steven Spielberg, Gertrude Stein, Simon and Garfunkel. Diesem Duo begegnete man zuvor schon, als Stephan Weber in der Neckargasse »Sounds of Silence« zur Gitarre sang und an einen jüdischen Händler erinnerte, der die Boykottplakate von seinem Laden riss: »Er will rufen: Ich bin doch einer von euch, einer der modernsten Geschäftsleute Im Theatersaal endet der Spaziergang derweil mit einem gesungenen Gedicht von Itzik Manger, einem jüdischen Poeten: »Dicht am Weg steht ein Baum« – ein Lied, das, symbolisch, von der Bedrohung des jüdischen Lebens erzählt.
Schwäbisches Tagblatt, 9. Juli 2024
Wie Unsichtbares sichtbar wird
(von Moritz Siebert)
Mit Tablet und Kopfhörer führt das LTT durch die von Antisemitismus geprägte Geschichte jüdischen Lebens in Tübingen. Es geht um die Frage, was man hätte tun können. Aber auch: Was kann man tun?
Gustav Lion riss die Boykottplakate runter. Wie bei anderen jüdischen Geschäftsinhabern hatten SA-Männer im April 1933 auch an seinem Laden in der Neckargasse 4 Plakate mit der Aufschrift „Kauft nicht bei Juden!“ angebracht. Gustav Lion floh 1934, zunächst ins Elsass, später nach Palästina. Seinen Textilwarenladen hatte er nur wenige Jahre davor gegründet. Heute ist in dem Haus ein Handyshop.
In einem theatralen Rundgang führt das LTT in Kooperation mit dem Förderverein für jüdische Kultur in Tübingen durch die Geschichte des jüdischen Lebens in der Stadt. Konzept und Idee für „Lebendige Stolpersteine“ stammen von der in Deutschland lebenden israelischen Regisseurin Sapir Heller. Start ist am Synagogenplatz: Der Rabbiner (Franziska Beyer) führt seine Gäste durch die 1882 eröffnete Synagoge, präsentiert stolz die Fassade, die Decke, den Blick ins Universum, den Blick nach Osten auf den Toraschrein. Es muss, das ist bekannt, bei der Vorstellung bleiben. Anstelle der Synagoge steht in der Gartenstraße heute ein Denkmal. Etwas erlebbar machen, das nicht mehr sichtbar ist, das nicht existiert, darum geht es beim Rundgang. In Tübingen gibt es nur rund 40 Menschen, die einer jüdischen Gemeinde angehören.
Der Rundgang gibt anhand einzelner Personen und Situationen Einblick in die Geschichte der Juden in Tübingen. Raum, einzelne Geschichten zu vertiefen, bleibt im Konzept allerdings nicht. Aufgearbeitet ist der Rundgang multimedial. Die Projektpartner haben dafür mit Studierenden der Medienwissenschaften sowie der Digital Humanities der Uni Tübingen zusammengearbeitet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit Tablet und Kopfhörer ausgestattet. Die Geräte liefern Infos auf den Strecken zwischen den Stationen, sind aber auch an den Stationen im Einsatz und bieten Hintergrund.
„Lebendige Stolpersteine“ führt zu den frühesten Zeugnissen jüdischen Lebens in Tübingen ins Jahr 1335 in die Judengasse. Die Gründung der Universität und deren Umstände werden beleuchtet: Als Bedingung ließ Graf Eberhard Jüdinnen und Juden aus der Stadt vertreiben. In der Neuen Straße trifft die Gruppe auf eine Witwe (Sabine Weithöner), die eine offene Rechnung mit sich trägt. Die Geschichte des Anwalts Simon Hayum, der bis 1933 im Tübinger Gemeinderat saß, wird erlebbar am Rathaus. In der Kronenstraße 6 bietet Herrenausstatter Leopold Hirsch (Dennis Junge) Waren feil: Im Jahr 1850 erlangte er nach mehreren Anträgen das Bürgerrecht – und wurde der erste jüdische Bürger der Stadt nach 400 Jahren. Hirschs Geschäft blieb in Familienhand – bis 1938.
Die letzte Station auf der Neckarinsel mit Blick auf das Verlagsgebäude des Schwäbischen Tagblatts erinnert an Albert Weil, Verleger der Tübinger Chronik, der Ende der 1920er Jahre in die Schweiz emigrierte. Dennis Junge und Jennifer Kornprobst stellen hier das berühmte Interview von 1964 mit Hannah Arendt nach, das hochaktuell ist, mit dem Ort aber nicht direkt zu tun hat.
Die Zuschauer werden selbst Teil des Konzepts. Sie können mit dem Tablet unterwegs fotografische Eindrücke sammeln, die am Ende an einer Wand im LTT präsentiert werden sollen. Sie nehmen an Umfragen teil und sind somit ständig mit der Frage konfrontiert, wie sie in welcher Situation selbst reagiert hätten. Boykottplakate abreißen oder ignorieren? Eine 30 Prozent-Quote für jüdische Mitglieder im Gemeinderat oder – die Kompromissvariante – eine etwas niedrigere Quote, dafür ein Denkmal?
Antrag angenommen: Die Bürgermeisterin (Jennifer Kornprobst) verkündet das Ergebnis vom Rathausbalkon. Außerdem soll es als „gelebte Wiedergutmachung“ koscheres Essen in Schulkantinen geben, ein christlicher wird durch einen jüdischen Feiertag ersetzt.
Die Frage, was hätte ich tun können, geht nicht ohne die Frage: Was kann ich tun? Das betrifft den Umgang mit Erinnerungskultur – auch angesichts zunehmender antisemitischer Anfeindungen gegen Juden im Land. Das Stück versucht, an die Gegenwart anzubinden, nicht bloß über die permanente Vergegenwärtigung der erschreckenden Tatsache, dass jüdisches Leben nur per digitaler Rekonstruktion sichtbar wird. Wie komplex und facettenreich die Frage aber ist, zeigen Szenen wie die erwähnte am Rathaus. Oder diese: Als die Teilnehmer des Rundgangs abstimmen sollen, ob nun Leopold Hirsch das Bürgerrecht erhalten soll, lässt die Inszenierung einen jungen Mann (Immanuel Krehl) dazwischenfunken, der sich lautstark über die Abstimmung beklagt und den Vergleich zur Gegenwart zieht: Angesichts der Wohnungsnot könne man doch heute auch nicht einfach jeden aufnehmen. Auch die Debatte um den Antisemiten Graf Eberhard, ob er als Namensgeber einer Universität würdig ist und ob mit einer Umbenennung Geschichte nicht getilgt worden wäre, streift das Stück. Wertvoll ist es auf jeden Fall, die Geschichten hinter den Stolpersteinen, die sonst, nur mit Namen und wenig Information über Biografien versehen, wenig Aufmerksamkeit haben, lebendig zu machen. Deutlich wird aber auch, dass es mit Stolpersteinen allein nicht getan ist.
cul-tu-re.de, 8. Juli 2024
(von Martin Bernklau)
„Lebendige Stolpersteine“ – ein Theaterspaziergang durch die Tübinger Altstadt widmete sich der lokalen jüdischen Geschichte und Leidensgeschichte
Nirgendwo anders hätte er beginnen können, der theatralische Stadtspaziergang „Lebendige Stolpersteine“ des LTT, der am Sonntagabend Premiere hatte: am Platz der Alten Synagoge, wo zum Gedenken ein rostiger Kubus steht und eine Rinnsal mit den eingravierten Namen der ermordeten oder emigrierten Tübinger Juden vom Brunnen herabläuft. Die multimediale Stadtführung mit professionellen szenischen Einlagen unter der Regie von Sapir Heller bot einen besonderen Service und hatte darin ihren Haken: die avancierte interaktive Technik.
Rund 50 Tablets und Kopfhörer mussten an die Premierenbesucher ausgegeben und erklärt werden, bevor Franziska Beyer als Rabbinerin und Vorsängerin im blutroten Kleid etwas von ihrer einstigen Gemeinde erzählen, ein liturgisches Lied anstimmen und dann eine imaginäre Besichtigung der Synagoge beginnen konnte, die 1882 in der Gartenstraße erbaut und in der „Kristallnacht“ des 9. November 1938 von einem SA-Mob geplündert und niedergebrannt worden war. Die Ruinen wurden bald darauf abgerissen, auf Kosten der Geschädigten.
Die kleine Filialgemeinde hatte (mit den Rottenburger Juden) nach der Machtergreifung der Nazis noch 77 Mitglieder, von denen 14 ermordet wurden und zwei den Freitod wählten. Es gibt zu ihrem Gedenken 108 Stolpersteine in Tübingen. Heute leben wieder rund 40 Juden in der Stadt, die sich religiös der Reutlinger Gemeinde zurechnen. Auf dem Weg in die Altstadt erfuhren die Spaziergänger auch davon, dass Tübingen und vor allem seine Universität – sie erklärte sich als erste deutsche Hochschule für „judenfrei“ – ein frühes und besonders fanatisiertes Zentrum des nationalsozialistischen Judenhasses und Rassenwahns war. Die Liste der Tübinger Kriegsverbrecher und Massenmörder – fast lauter Akademiker, oft Juristen – ist erschreckend lang.
Seit dem Jahr 1337 ist jüdisches Leben in Tübingen dokumentiert, erfuhr man. Um diese Zeit gab es hinter dem Rathaus die Judengasse, die bis heute so heißt, und deren mittelalterliche Geschichte Franziska Beyer dort später im eleganten engelhaften Kleid (Raumgestaltung und Kostüme: Sarah Elena Kratzl) beleuchtete: Nach mehreren Pogromen zur Pestzeit wurden fast alle Tübinger Juden 1456 aus der Stadt vertrieben, Graf Eberhard im Bart wies sie 1477 im Jahr seiner Universitätsgründung endgültig aus. Vor ein paar Jahren scheiterte die Initiative knapp, deswegen den Namen der Uni zu ändern. Solche Infos konnte die Spaziergänger auch durch Abscannen von Plakaten auf ihr Tablet holen.
Zunächst aber teilte sich die Gruppe in der Neckargasse, wo sich bald nach Hitlers Machtantritt vorn am Neckartor die Antisemiten im früh schon „judenfreien“ Tanzcafé „Pomona“ trafen und etwas oberhalb der Geschäftsmann Gustav Lion seinen Laden hatte und tapfer immer wieder die Plakate abriss, die zum Boykott jüdischer Geschäfte aufriefen. Oben an der Stiftskirchenmauer gab Stephan Weber Lieder zur Gitarre und ließ per Tablet abstimmen, ob man genauso gehandelt oder die Hetze ignoriert hätte.
Enteignet und vertrieben wurden oben am Holzmarkt auch die Familie von Jakob Oppenheim, dem jüdischen Gemeindevorsteher und Geschäftsführer des Bekleidungshauses Degginger. Das erste Haus am Platz wurde zum Modehaus Haidt „arisiert“. Heute beherbergt es „New Yorker“, dessen Signet auf den Tablets zu „Jew Yorker“ umgestylt wurde.
Im oberhalb und außerhalb der Stadt gelegenen Härtenort Wankheim hatten sich nach 400 Jahren schon wieder ein paar jüdische Familien angesiedelt, als im Jahr 1850 Leopold Hirsch das Tübinger Bürgerrecht beantragte. Zweimal wurde es vom Gemeinderat abgelehnt, beim dritten Versuch von der königlich-württembergischen Landesherrschaft in Stuttgart aus genehmigt. In der Kronengasse 6, wo sechs Stolpersteine im Pflaster verlegt sind, die an die nach Südafrika geflüchtete Familie erinnern, hatten Leopold Hirsch und seine Nachfahren ihr Geschäft.
Dort gab es einen Zwischenfall: Ein Bewohner im Obergeschoss des baufälligen Hauses protestierte durch mehrfaches lautes Fensterschließen gegen das Geschehen. Bei den Proben zum Stück war es in der Judengasse noch heftiger zugegangen: Ein Palästinenser-Sympathisant hatte den vermeintlichen Juden Schläge angedroht.
In der Langen Gasse hatte Sabine Weithöner als Schwarze Witwe und verbitterte Rächerin ihres durch den Gashahn ums Leben gebrachten Gatten einen großartigen kleinen theatralischen Auftritt – zu literarischen Texten, unter anderem von Paul Celan und seinem Golem. „Die Rechnung ist noch offen!“ rief die fiktive Rächerin in ihrem Furor.
Das von der israelischen Regisseurin Sapir Heller und ihrem Dramaturgen Adrian Herrmann konzipierte Event verzichtete auch sonst nicht auf gedankliche Stolpersteine, Verstörungen und Provokationen: Am Marktplatz sollte über eine jüdische 30-Prozent-Quote im Gemeinderat abgestimmt werden. Tatsächlich war eine Mehrheit dafür und dürfte sich deshalb eine groteske Rede Jennifer Kornprobsts vom Rathausbalkon herab anhören.
Auf der Platanenallee gegenüber dem Verlagsgebäude des „Schwäbischen Tagblatts“ wurde an den jüdischen Verleger Albert Weil erinnert, der seine damalige „Tübinger Chronik“ aufgeben und mit seiner Familie in die Schweiz emigrieren musste. In zwei Sesseln spielten dort Dennis Junge und Jennifer Korngold das legendäre „Zur Person“-Fernsehgespräch nach, in dem der Journalist Günther Gaus die kettenrauchende jüdische Philosophin Hannah Arendt nach ihren Jugenderinnerungen in Königsberg, der beginnenden Judenverfolgung in den Nazijahren und nach den weltweiten Reaktionen auf ihr Buch über den Prozess gegen den Holocaust-Planer Adolf Eichmann („Die Banalität des Bösen“) in Jerusalem befragt.
An dieser Neckarfront und auf der Brücke, die Schokoladenseite Tübingens im Blick, durften die Theatergänger mit ihren Tablets auch Fotos machen, die dann beim Abschluss in der LTT-Werkstatt gezeigt wurden, wo es noch jiddische Gesänge zum Klavier, danach Bier und Hummus gab und sich das Ensemble für ein eindrückliches Projekt feiern lassen durfte, das sich mit der Fülle seiner multimedialen Informationen, Anregungen und Anstöße, dazu ein paar szenischen Highlights allenfalls den einen Einwand gefallen lassen muss: dass diese „Lebendigen Stolpersteine“ den Zuschauern ein Multi-Tasking abverlangten, mit dem sie womöglich stellenweise (vom Technischen ganz abgesehen) etwas zu stark gefordert waren – und ihre Aufmerksamkeit teils sehr gesplittet wurde.
Nicht erst am Ende des Stolperstein-Spaziergangs aber stellten die Akteure die Frage: Was kann man heute tun? Vor allem ausgerechnet seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 ist unverhüllter Judenhass – unter dem Vorwand von Israels Gaza-Krieg – weltweit geradezu tsunamihaft angeschwollen. Auch in Deutschland, auch in Tübingen wieder.
Nachtkritik.de, 8. Juli 2024
(von Steffen Becker)
In Tübingen fühlt sich nur noch eine Handvoll Menschen der jüdischen Gemeinde zugehörig. Einst war das anders. Regisseurin Sapir Heller lässt mithilfe von Augmented Reality und Tablets auf einem theatralen Spaziergang die jüdische Geschichte der Stadt lebendig werden.
8. Juli 2024. Zum Schluss des Tübinger Theaterrundgangs "Lebendige Stolpersteine" hört man einen Podcast, in dem der Dramaturg gefragt wird, ob er Juden kennt. "Das ist eine spannende Frage", hebt er an und antwortet dann: "nein" – zumindest für die Zeit vor dem Projekt unter der Regie der in Israel geborenen Regisseurin Sapir Heller. Das Interview trifft den Kern der "Lebendigen Stolpersteine": Wie umgehen mit jüdischer Geschichte ohne jüdische Gegenwart? In Tübingen gibt es nur noch 40 Personen, die sich einer jüdischen Gemeinde zugehörig erklären. Die Zahl der Gedenktafeln in der Stadt dürfte höher liegen.
Das Landestheater versucht es daher mit Augmented Reality. Man steht vor einem Klamottenladen, scannt alte Fotos und sieht, wie sich das "New Yorker"-Logo in ein "Jew Yorker" verwandelt (und der Fast Fashion-Laden wieder das mondäne Antlitz eines 1920er-Modehauses erhält). Ähnliches wiederholt sich an der Alten Synagoge, die es seit 1938 nicht mehr gibt. Am heutigen Gedenkort kann man sich von Schauspieler*innen per Video die Geschichten ihrer Besucher erzählen lassen. In real gibt Franziska Beyer den Rabbiner, der die Synagoge 1882 eröffnete.
Zwischen Wohnhäusern und Biergarten versucht sie auf dem Rundgang, den Mittelpunkt jüdischen Lebens auferstehen zu lassen. Abweichend vom Skript kommentiert sie den Elefanten des heutigen indischen Restaurants als Baal, der sich in den Tempel verirrt hat. Die Bedienung tritt irritiert aus dem Eingang, während dieser als Platz des Tora-Schreins beschrieben wird. Absicht oder nicht – die absurde Szene zeigt, dass jüdisches Leben heute vor allem als Simulation existiert. Man bestaunt die von der Gegenwart überwucherten Artefakte. Im Alltag stört das Vergangene nicht. Zumindest phasenweise durchkreuzen die "Lebendigen Stolpersteine" dieses Arrangement.
Man steht vor dem Rathaus und darf am Tablet über die nächste Szene abstimmen – Verkündung eines Referendums über eine 30-Prozent-Quote für Juden im Gemeinderat. Ja/Nein oder super-deutsch: "Nein, aber dafür gibt es ein Mahnmal". Gescriptet oder nicht: Jennifer Kornprobst tritt als enthusiastische Bürgermeisterin auf den Balkon und verkündet als zusätzliche Maßnahme die Umstellung der Kantinen auf koscheres Essen. Wer die Debatten über Veggie-Days oder "kein Schweinefleisch im Kindergarten" verfolgt hat, kann sich ausmalen, wohin das führen würde.
Komplizierter wird es bei der zweiten Leitfrage des Abends: "Was tun wir heute?". In einer Gasse darf man über den ersten Antrag auf Wohnrecht eines Juden nach 1848 befinden (damals mehrfach abgelehnt). Bevor man auf "Ja" klicken kann, crasht Immanuel Krehl als junger Wutbürger die Szene mit dem Hinweis, dass man aus heutiger Sicht ja auch nicht jeden Flüchtling hier aufnehmen könne bei der großen Wohnungsnot (der ex-Grüne OB Boris Palmer, der by the way gerne auf die jüdischen Wurzeln seines Vaters verweist, hat mit diesem Argument "Wir können nicht allen helfen" einen Bestseller geschrieben).
Dann gibt es noch einen Rekurs auf die Debatte um die antisemitischen Namensgeber der Eberhard-Karls-Universität sowie eine knappe Reflexion über jüdische Identität in Deutschland nach dem 7. Oktober. Ab hier wird es unübersichtlich.
Das Konzept von Sapir Heller hakt an der Stelle: Die Frage "Was tun" kann in der Kürze der Zeit, der Stationen und angesichts der komplexen Gemengelage nicht ausbuchstabiert werden. Letztere spürt man aber so oder so unwillkürlich, wenn man die Szenerie checkt: Droht im abendlichen Trubel Gefahr, wenn im szenischen Teil laut das Wort Jude fällt? Der Blick erhascht beim Rundgang das eine oder andere #freegaza an den Hauswänden. Auf dem Tablet kann man derweil virtuell Boykott-Plakate von 1933 herunterreißen.
Auf der Neckarinsel erinnert in einem Reenactment eines ikonischen Interviews Hannah Arendt daran, dass im Moment der höchsten Gefahr nicht entscheidend ist, was die Feinde tun, sondern wie sich die Freunde verhalten. Da schwirrt der Kopf angesichts der vielen verschiedenen Ebenen, auf denen jüdisches Leben derzeit verhandelt wird. Immerhin: für die Socialwall, die man zum Abschluss des Abends im LTT bewundern kann, hat ein Teilnehmer beim Rundgang auch einen FCK HMS (Fuck Hamas)-Sticker fotografiert. Ein kämpferischer Stolperstein der Hoffnung, gefunden außerhalb des Skripts, immerhin.